Das Leben ist zu kurz, um nicht zu tanzen. Es ist auch zu real, um nicht zu tanzen. Ben Becker tut es trotzdem. Ich auch.

Auch Friedrich Nietzsche tanzt. Nichts ist schöner, als in Ketten zu tanzen.
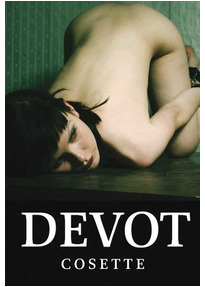
Sie tanzt für mich in Ketten. Nur ich kann ihren zarten Tanz sehen.
Wir, die wir die wahren Genüsse des Lebens kennen, tanzen gerne auch im Regen, wie Gene Kelly.

Gelegentlich, vor allem im beginnenden Frühling, werde ich von einer Dame auf die Tanzfläche gebeten. Wenn sie es offensichtlich ernst meint, gebe ich mich dem auch hin.

Ob klassisch beim Ballett oder ausgelassen im Club: Tanzen hebt die Stimmung und fördert die Gesundheit. Vor allem, wenn man sich auf dem Parkett das sucht, was einem im Alltag fehlt, erklärt die Neurowissenschaftlerin Julia F. Christensen.
Von A wie argentinischer Tango über M wie Macarena bis hin zu Z wie Zumba: Kaum eine Bewegungsart ist so vielfältig wie das Tanzen. Hin und wieder eine heiße Sohle aufs Parkett zu legen, tut Körper und Psyche gut, das zeigen mittlerweile zahlreiche Studien. Denn Tanzen verknüpft im Vergleich zu anderen Sportarten gleich drei positive Aspekte miteinander, berichtet die Neurowissenschaftlerin Julia F. Christensen vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Im Interview erklärt sie, was es im Gehirn bewirkt und ob es Tanzstile gibt, von denen man mehr profitieren kann als von anderen.
»Spektrum.de«: Frau Christensen, Sie haben selbst eine enge Bindung zum Tanzen und genossen unter anderem eine professionelle Tanzausbildung. Wann haben Sie das letzte Mal getanzt?
Julia F. Christensen: Gestern Abend erst, um ein paar Schritte für mich allein zu üben. Vergangenes Wochenende war ich auf einer Milonga, einer Abendveranstaltung, auf der hauptsächlich Tango Argentino getanzt wird. Das mache ich relativ regelmäßig. Außerdem gehe ich auf Grund eines Rückenleidens ab und zu zum Ladies-only-Bauchtanz-Unterricht. Das hilft mir mitunter besser als jede Physiotherapie – und es bringt sehr viel Spaß.
Sie erforschen seit einigen Jahren als Psychologin und Neurowissenschaftlerin, wie sich Tanzen auf das Gehirn, die Gesundheit und die Psyche auswirkt. 2018 haben Sie gemeinsam mit Ihrem Kollegen Dong-Seon Chang ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel »Tanzen ist die beste Medizin«. Würden Sie das heute, mit Blick auf die aktuelle Studienlage, immer noch sagen?
Dass man Tanzen wissenschaftlich erforschen kann, war mir während des Studiums nicht gleich klar. Dann bekam ich durch Zufall eine Studie in die Hände, für die Tänzer in den Magnetresonanztomografen (MRT) geschoben worden waren. Dabei zeigte sich, dass sie Bewegungen anders wahrnehmen als Nichttänzer. Ich fand das unglaublich spannend und habe dann daraus mein Forschungsfeld entwickelt. Es gab damals aber nur sehr wenige Untersuchungen zum Thema Tanzen und Gehirn.
Als wir unser Buch geschrieben haben, habe ich bis zum letzten Moment der Abgabe die wissenschaftlichen Datenbanken durchforstet, um wirklich jede Studie aufzunehmen, die zu diesem Zeitpunkt zu dem Thema verfügbar war. Seitdem sind ein paar Jahre vergangen, und es gibt inzwischen viel mehr Untersuchungen. Dadurch können wir langsam einen etwas differenzierteren Blick wagen. Letztlich kann man sagen, dass es beim Tanzen wie bei jeder »Medizin« Risiken und Nebenwirkungen gibt. Und wenn man diese kennt, kann man auch die gesundheitsfördernden Effekte des Tanzens besser für sich nutzen.
Wann ist Tanzen gesund und wann nicht?
Unser Gehirn und unser Körper sind über das Rückenmark verbunden. Das bedeutet: Sie beeinflussen sich gegenseitig. Wenn wir in Wettbewerb mit anderen treten oder unter Anspannung stehen, dann werden im Gehirn Systeme aktiviert, die Stresshormone ausschütten. Dieser Mechanismus sicherte ursprünglich unser Überleben in der Wildnis und bereitete uns in Gefahrensituationen für Kampf oder Flucht vor, aber kompetitiv zu tanzen kann ihn ebenfalls aktivieren. Erste Studien deuten darauf hin, dass es eher der Hobby-Tanz ist, der den Spiegel des Stresshormons Kortisol sinken lässt. Professionelle Tänzer oder solche, die gerade ein Tanzabzeichen machen, haben hingegen oft einen sehr hohen Kortisolpegel. Gerade Profitänzer sollten daher unbedingt darauf achten, zwischendurch auch mal nur zum Spaß zu tanzen.
Tanzen kann also – je nach Situation – die Ausschüttung von Stresshormonen fördern oder bremsen. Was macht es noch mit dem Gehirn?
Tanzen aktiviert eine ganze Reihe von neuronalen Netzwerken. Ich werde häufig gefragt, wo das Tanzzentrum ist, und antworte dann manchmal: »Die Straße runter.« Im Gehirn gibt es das eine Areal, das fürs Tanzen zuständig ist, nicht.
Eine wichtige Rolle spielen beim Tanzen natürlich die motorischen Systeme, aber die sind bei nahezu allem aktiv, was wir tun. Alle Bereiche des Gehirns sind auf irgendeine Weise mit dem Bewegungssystem verbunden. Das macht Bewegung so wichtig für unser Leben und für unsere Gesundheit.
Neben unseren Sinnessystemen werden durch das Tanzen diejenigen Areale angesprochen, die an der Verarbeitung von Emotionen, sozialen Reizen und ästhetischen Empfindungen beteiligt sind. Und schließlich ist Tanzen eine Ausdrucksform, eine Körpersprache. Wenn wir einen Tanzstil lernen, erweitern wir im Prinzip unser Vokabular an Gesten, mit denen wir uns ausdrücken und mit anderen kommunizieren. Es gibt erste, vorsichtige Hinweise darauf, dass Tanzen im Gehirn wie eine Art Sprache verarbeitet wird. So haben vergleichende Studien ergeben, dass jene Hirnregionen, die akustische Reize verarbeiten, über lange Nervenfasern mit den großen Muskeln unseres Körpers verknüpft sind. Die meisten anderen Tiere haben diese Verbindungen nicht. Das könnte erklären, warum nur ganz wenige Spezies überhaupt dazu in der Lage sind, sich rhythmisch zur Musik zu bewegen. Singvögel sind – neben Menschen – eine dieser wenigen Ausnahmen. Die Forschung dazu steht allerdings noch ganz am Anfang.
Welchen Unterschied macht es für meine Gesundheit, ob ich tanze oder einer anderen Sportart nachgehe?
Beim Tanzen kommen gleich drei Aspekte zusammen, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken: Bewegung, Musik und die soziale Komponente. Bewegung, das wissen wir, ist gut für unseren Körper. Leider sitzen die meisten Menschen viel zu viel. Studien zeigen, dass wir uns pro Woche ungefähr 180 Minuten aerob, also mit mittlerer Intensität, bewegen müssen, um auf lange Sicht gesund zu bleiben. Tanzen erfüllt diese Bedingung. Dann haben wir die Musik. Sie kann den Parasympathikus aktivieren, den Teil des vegetativen Nervensystems, der die Erholungs- und Ruhephasen begünstigt. Dadurch werden Reparatur- und Heilungsprozesse im Körper angestoßen und das Immunsystem wird reguliert. Außerdem aktiviert Musik, die wir mögen, das Gedächtnis und die Genusssysteme im Gehirn. So wächst unsere intrinsische Motivation, weiterzumachen – beim Sport ein entscheidender Faktor! Die soziale Komponente kann sich schließlich auf zwei Wegen förderlich auswirken. Zum einen über die Berührungen, wenn man mit einem Partner tanzt. In unserer Haut gibt es spezielle Rezeptoren, die Berührungen wahrnehmen und die mit Hirnarealen verschaltet sind, die auch die Immunantwort steuern. Der andere Aspekt kommt bei Gruppentänzen zum Tragen: Synchrone Bewegungen können dazu führen, dass unser Gehirn die Wahrnehmung der Bewegungen anderer Menschen und von uns selbst, salopp gesagt, ein wenig »überlappen« lässt. Das kann dafür sorgen, dass wir uns anschließend sympathischer sind, wir hilfsbereiter miteinander umgehen und sogar Probleme zusammen besser lösen können.
Wirkt sich Tanzen auch positiv auf die Psyche aus?
Schon ganz kurze Tanzpausen haben eine stimmungsaufhellende Wirkung, wie wir erst kürzlich nachweisen konnten. Für eine Studie brachten wir Versuchspersonen kurze, ballettartige Sequenzen mit den Armen bei und baten sie, damit fröhliche und neutrale Gefühle auszudrücken. Nach dem fröhlichen Ausdruck waren die Probanden nicht nur besser gelaunt, sondern außerdem war ihre Arbeitsmotivation gestiegen.
Viele Menschen kennen wahrscheinlich schon die stimmungsaufhellende Wirkung des Tanzens. Sie könnte mit besagter Kombination aus Bewegung, Musik und sozialen Kontakten zusammenhängen, die beim Tanzen zusammenkommen. Die Forschung steht allerdings noch am Anfang, um diese spannende Frage zu beantworten. Von den sozialen Neurowissenschaften wissen wir aber, dass unser Gehirn bei gemeinsamen Handlungen, die uns gefallen, das Bindungshormon Oxytozin ausschüttet sowie die Botenstoffe Dopamin und Serotonin, die mit Gefühlen von Glück und Motivation in Verbindung stehen. Man könnte vielleicht sogar sagen, der Körper produziert beim Tanzen sein eigenes Antidepressivum. Tanzen ersetzt dabei jedoch keine Therapie. Wer vermutet, eine Depression oder eine andere psychische Erkrankung zu haben, sollte sich unbedingt professionelle Hilfe suchen.
Es gibt verschiedene Arten zu tanzen. Vom technisch anspruchsvollen Ballett, das ganze Geschichten erzählen soll, über Tango Argentino oder Wiener Walzer, wo der Umgang mit dem Partner vielleicht erst einmal die größte Herausforderung ist, bis hin zu Zumba, einem Fitnesstanz, der an Aerobic und Kardiotraining erinnert. Macht es einen Unterschied für mein Gehirn und meine Psyche, wie ich tanze?
Die Forschung ist heute noch nicht so weit, dass wir dazu viel sagen könnten. Man kann sich aber ein wenig behelfen, indem man schaut, welche Prozesse die verschiedenen Tanzstile ansprechen. Stile, bei denen man viele verschiedene Bewegungen lernen und miteinander koordinieren muss, beispielsweise Ballett oder klassischer indischer Tanz, schulen die kognitive Flexibilität gegebenenfalls mehr als Tänze wie Tango Argentino, die vergleichsweise wenige Grundschritte haben. Dafür hat man beim Tangotanzen meist mehr Körperkontakt.
Wie sehr eine Person im Einzelnen von einem Tanzstil profitiert, hängt letztlich auch davon ab, was sie braucht und was ihr im Alltag fehlt. Wenn ich den ganzen Tag über einsam vor dem Computer hocke, dann ist eine soziale Tanzsituation womöglich besser für mich als ein Stepptanzkurs. Wenn ich viel sitze, kann ich mir bewusst einen besonders aktiven Stil wie Zumba suchen. Bin ich hingegen im Job viel auf denen Beinen, wähle ich vielleicht lieber etwas Ruhigeres.
Das Gleiche gilt für Menschen, die bestimmte Erkrankungen haben. Es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass Parkinsonpatienten mehr von argentinischem Tango profitieren als von Wiener Walzer. Das überrascht nicht. Betroffene haben oft Schwierigkeiten, Bewegungen zu initiieren und die Balance zu halten. Und diese Fähigkeiten werden in einem Tango Argentino, der viele Stopps enthält, mehr trainiert als in einem Walzer, bei dem man sich fortwährend dreht.
Manche Menschen mögen keine festgelegten Choreografien und Schritte, sondern tanzen lieber im Club so, wie es ihnen gerade in den Sinn kommt. Kann man auch in solchen Situationen von den positiven Effekten des Tanzens profitieren?
Ich würde sagen ja. Manche Menschen fühlen sich in der Dunkelheit und der Anonymität eines Clubs auch einfach freier, um zu tanzen, sich auszudrücken, loszulassen. Es gibt schon Forschungsergebnisse aus der Clubszene, allerdings muss man beachten, dass dort künstliche Drogen eine große Rolle spielen, je nachdem, auf welchen Veranstaltungen man unterwegs ist. Tanzen unter Drogeneinfluss ist natürlich nicht gesund.
An sich ist das freie Tanzen aber die grundlegende Form des Tanzens, die uns praktisch in die Wiege gelegt worden ist. Schon Babys synchronisieren ihre Gehirnwellen zur Musik. Wir betrachten das Tanzen hier zu Lande oft als hohe Kunst, die nur Profis vorbehalten sein sollte. Doch damit sabotieren wir uns und unsere Tanzlust letztlich selbst.
Sie haben bereits erwähnt, dass ein Tango-Argentino-Kurs die Symptome von Parkinsonpatienten lindern kann. Was weiß man noch über solche therapeutischen Effekte?
Es gibt eine spannende Studie aus Italien zu diesem Thema. Darin wurden Patienten mit einer chronischen Herzinsuffizienz in drei Gruppen eingeteilt: Eine erhielt acht Wochen lang ein klassisches Training auf Fahrrad und Laufband, eine andere tanzte acht Wochen lang Walzer und die übrigen Probanden fungierten als Kontrollgruppe und erhielten gar keine Intervention. Die Herzgesundheit und die Fitness verbesserte sich bei allen Teilnehmern, die eines der beiden Trainingsprogramme absolviert hatten. Aber aus der Tanzgruppe brachen deutlich weniger Freiwillige ab. Außerdem ging es ihnen nach Abschluss emotional besser als jenen, die einfach nur Sport gemacht hatten.
Hilft Tanzen auch, neurodegenerativen Erkrankungen wie Demenz oder Parkinson vorzubeugen?
Es gibt einige populationsbasierte Studien, die das suggerieren. Allerdings ist die Interpretation der Ergebnisse schwierig, weil man nie alle Eigenschaften, in denen sich die Probandinnen und Probanden unterscheiden, auf dem Schirm haben kann. Am Ende kommt es wie bereits erwähnt darauf an, was ich mit dem Tanzen erreichen möchte. Will ich neurodegenerativen Erkrankungen vorbeugen, dann sollte ich mir eher einen Tanzstil suchen, der viel Bewegungskoordination erfordert. Möchte ich das Risiko für Herzleiden minimieren, dann benötige ich vor allem die 180 Minuten Training in der Woche.
Falls der ein oder andere Leser oder die eine oder andere Leserin nun Lust bekommen hat, die Tanzschuhe wieder abzustauben: Was würden Sie dieser Person raten?
Der Anfang ist immer am schwersten. Es ist normal, nervös zu sein, sich zu schämen, vielleicht sogar Angst davor zu haben, zu versagen, wenn man etwas Neues beginnt. Ziehen Sie sich etwas Bequemes an, das trotzdem schön aussieht. Suchen Sie sich einen Ort zum Tanzen, an dem Sie sich wohlfühlen. Fahren Sie vielleicht in einen anderen Teil der Stadt, in dem Sie niemand kennt, wenn Sie lieber unter Fremden sein möchten. Probieren Sie verschiedene Tanzstile aus. Die Menschen bei einem Swingdance-Abend sind anders als die Teilnehmer einer Salsa-Nacht oder einer Milonga. Je nachdem, wie man selbst tickt, wird man sich mit den einen wohler fühlen als mit den anderen.

