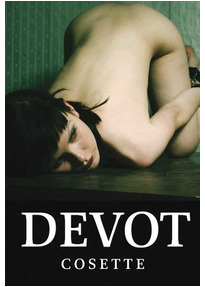Und schon stecken wir mitten in einer Kernthese von Illouz: „Gleichheit, so heißt es, sei nicht besonders sexy, weil sie Konsens, Verhandlungen und Prozeduren voraussetze“, schreibt die Soziologin. Die Wald- und Wiesenklage, die Gleichberechtigung des modernen heterosexuellen Paars gehe einher mit Unsicherheiten auf allen Ebenen und folglich mit einem Niedergang des sexuellen Begehrens, führe zum allgemeinen Konsens, dass Frauen sich (zumindest im Bett) nach traditioneller Männlichkeit sehnten, „die sich ihrer selbst und und sexuellen Macht sicher ist“.

Denn die Ungleichheit (also das aus ihr abgeleitete Verhältnis von beschützendem Mann und abhängiger Frau) verfügte auch über angenehme Aspekte, von denen einer die Klarheit der Geschlechterrolle gewesen sei.
Zudem führten traditionelle Rollen zu einem „starken emotionalen ‚Klebstoff‘“, nämlich der wechselseitigen Abhängigkeit. BDSM schaffe es, klare Rollen wieder herzustellen, ohne zur traditionellen Geschlechterungleichheit zurück zu kehren – „die Ungleichheit […] ist spielerischer Natur und nicht in eine soziale Ontologie der Geschlechter eingeschrieben“. So könnten die Subjekte eine Position aus der geschlechtlichen Ontologie herauslösen – immerhin seien es häufig Männer in Machtpositionen, die den masochistischen Part übernehmen. „Gleichheit hingegen ist von Haus aus konfuser, weil auf dieser Grundlage keine Rollen festgelegt oder bewertet werden können; in diesem Sinn führt Gleichheit zu Unsicherheit und Zwiespältigkeit.“ Damit muss man in einer stets komplexer und unsicherer werdenden Welt erst einmal umgehen können.
Zudem seien moderne Liebesbeziehungen „von einer diffusen Form des seelischen Leidens“ gekennzeichnet, etwa von Verängstigung, Unsicherheit sowie der Schwierigkeit, Autonomie und Bindung unter einen Hut zu bringen. BDSM übersetze dieses seelische Leid in körperlichen Schmerz, mache ihn aber kontrollierbar und dank eines Codewortes jederzeit beendbar. Bei BDSM müssen die Parameter der Erfahrung, auf die man sich einlässt, sorgsam definiert und inszeniert werden. Es handele sich folglich um eine „reine Form von Konsens – ohne jenen Rest dessen, was sich aus den endlosen Verhandlungen des alltäglichen Lebens in ‚reinen Beziehungen‘ an Nichtvereinbartem und Improvisiertem ergibt.“