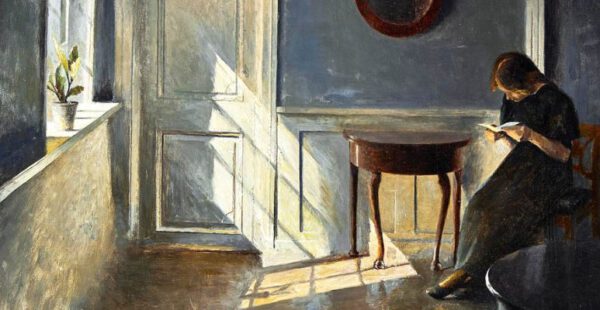Es ist zum Heulen, wie viel in der Liebe schiefgehen kann, weil wir eine einfach klingende, aber enorm wichtige Fähigkeit nicht beherrschen: die Kunst, unsere Wünsche frühzeitig und auf eine Weise, die Gehör finden kann, mit Sanftheit und Selbstbeherrschung auszudrücken, bevor unsere Gefühle irreparablen Schaden nehmen. Wir haben einfach nie gelernt, unsere Bedürfnisse auf eine gute Weise zum Ausdruck zu bringen – nicht mit Drama oder Vorwürfen, sondern mit Aufrichtigkeit und Fürsorge.
Stellen wir uns vor, wir sind schon seit langer Zeit Single. Es gab viele Monate, vielleicht sogar Jahre, in denen wir uns gefragt haben, ob wir es überhaupt verdienen, mit jemandem zusammen zu sein, an unseren Qualitäten gezweifelt haben und befürchtet haben, dass die Liebe vielleicht nie wieder zurückkehren würde.
Dann taucht plötzlich jemand in unserem Leben auf, der oder die durchaus vielversprechend zu sein scheint. Die Person sieht toll aus, kann sich gut unterhalten, interessiert sich für uns und wir haben aufregende Gespräche miteinander geführt.
Dann erwähnt die Person immer öfter, wie gerne sie segelt und dass sie sich mit Freunden ein kleines Boot auf dem See teilt. Ihre Begeisterung für das Segeln ist unübersehbar. Sie möchte unbedingt, dass wir mitkommen und ihr Hobby gemeinsam genießen. Sie erwähnt einen Ex, der oder die nicht so begeistert war – und wie ungünstig das für die Beziehung gewesen sei.
Die Erwartungen sind hoch. Also gehen wir mit – natürlich tun wir das – und wir bemühen uns sehr, gute Segler zu sein. Wir machen Komplimente für das (überraschend kleine) Boot, wir bewundern die Aussicht, wir helfen beim Segeln, wir geben allgemein unser Bestes. Doch dann, nach der dritten schlaflosen Nacht, seekrank und erschöpft, ertragen wir es nicht mehr. Ein Teil von uns möchte die andere Person anschreien, weil sie nicht merkt, wie unwohl wir uns fühlen. Wir hassen sie für ihr egoistisches Hobby, möchten am liebsten sofort an Land schwimmen und nie wieder Kontakt aufnehmen.
Es gibt viele Variationen dieses Problems in verschiedensten Bereichen: Der oder die andere liebt lange Spaziergänge auf dem Land. Oder Gitarre spielen. Oder über hinduistische Poesie sprechen. Die Person gärtnert ständig oder hat eine bestimmte Vorliebe im Bett, mit der wir wenig anfangen können und die uns einschüchtert.
Unsere Bedürfnisse sind legitim
In einer idealeren Welt wären wir schon von klein auf auf solche Momente vorbereitet worden. Neben dem Physik- und Geografieunterricht hätten wir in unseren Stunden zur emotionalen Kommunikation gelernt, wie wir über unsere intimsten Bedürfnisse sprechen können, ohne andere zu verletzen. Der Lehrer hätte uns gesagt, dass wir von einer fundamentalen Überzeugung ausgehen sollten: Unsere Bedürfnisse sind legitim.
Es ist nichts falsch daran, wenn wir nicht gerne segeln, keine anstrengenden Wanderungen unternehmen wollen, uns nicht für Pferde begeistern können oder wir Angst vor alten Kirchen haben. Das sind keine problematischen Gefühle – das sind einfach wir.
Gleichzeitig ist es nicht fair, gar nichts zu sagen und dann, wenn wir am Ende unserer Kräfte sind, unsere Bedürfnisse lautstark zu äußern, unsere Wut voll auszuleben und der anderen Person vorzuwerfen, dass sie unsere Gedanken nicht lesen kann, obwohl wir uns nie die Mühe gemacht haben, uns zu öffnen. Natürlich ist es ihre Pflicht, zuzuhören, aber es ist ebenso unsere Pflicht, zu sprechen.
Wir müssen einen Weg finden, schwierige Botschaften auf ausgeglichene Weise zu vermitteln. In der idealen Schule könnte es sogar Wettbewerbe geben, in denen wir uns spielerisch darin üben, mit den schwierigsten Botschaften am effektivsten umzugehen.
Beispielfragen könnten sein:
- Dir sind die religiösen Ansichten der anderen Person nicht geheuer. Was sagst du?
- Dir kommt es seltsam vor, wie nah die andere Person ihrer Schwester steht. Was sagst du?
- Die andere Person glaubt, dass du ihre Kochkünste liebst, aber das tust du nicht wirklich. Was sagst du?
Zur Vorbereitung auf solche Gespräche können wir uns bestimmte Satzbestandteile zurechtlegen, die uns helfen:
1. Wir können beruhigend anfangen: „Ich liebe dich sehr. Das einzige, was mich stört …“ „Bitte sei dir bewusst, dass ich das nur sage, weil mir so viel an dir und an uns liegt …“ „Meine Bewunderung für dich ist grenzenlos. Sonst wäre ich nicht hier, es gibt aber gerade eine Sache, die …“
2. Wir können unsere Position aus einer entspannten Überzeugung heraus vortragen, dass sie berechtigt ist: „Ich habe gerade Schwierigkeiten beim Schlafen …“ „Ich fühle mich immer viel wohler, wenn …“ „Ich weiß, dass die meisten Menschen in dieser Frage nicht meiner Meinung sind, aber …“
3. Wir können Raum für Meinungsverschiedenheiten schaffen. Unser Gegenüber muss unsere Meinung nicht übernehmen. Wir suchen keine perfekte Übereinstimmung, sondern nur ein ausreichendes Verständnis füreinander. „Es ist für mich in Ordnung, dass wir das unterschiedlich empfinden …“ „Ich weiß, dass du mir in diesem Punkt nicht zustimmst, aber hoffentlich …“
4. Sollte auch danach noch alles schieflaufen – wenn die andere Person außer sich ist und uns Vorwürfe macht –, dann haben wir uns selbst einen großen Gefallen getan. Wir haben das Problem frühzeitig ans Tageslicht gebracht und müssen uns jetzt möglicherweise – traurig, aber zügig – aus der Situation zurückziehen und uns anderweitig umsehen. Jemand, der keinen Raum für unsere höflich und vorsichtig formulierten Einwände hat, kann, unabhängig von allen sonstigen Qualitäten, nicht der richtige Partner für uns sein. „Du bedeutest mir sehr viel, aber ich glaube nicht, dass wir uns damit einen Gefallen tun, wenn wir …“
Idealerweise hätten wir all das in der Schule gelernt. Aber natürlich wäre es noch besser gewesen, wenn die Grundlagen dafür zu Hause gelegt worden wären. Wenn, als sich unsere Bedürfnisse zeigten, ein Elternteil für uns da gewesen wäre, um uns vorzuleben, wie man seine Gefühle ausdrückt, ohne anderen wehzutun oder aber uns selbst aufzugeben.
Viele Beziehungen scheitern, weil jemand die Sprache verloren hat
Es wäre eine große Hilfe gewesen, wenn ein Elternteil uns gesagt hätte, als wir uns das erste Mal in der Schule nicht getraut haben, nach etwas zu fragen: „Es ist völlig Ok. Du musst einfach die Hand heben und es höflich erklären, dann werden sie es verstehen.“ Oder: „Sag Sophies Mutter einfach, dass du keinen Schokoladenkuchen magst und dass du mit etwas Einfachem wie Brot und Butter zufrieden bist.“ Und wenn unsere Eltern uns auch das Gefühl hätten vermitteln können, dass wir jedes Recht haben, uns keine Vorwürfe zu machen, wenn jemand kein Verständnis für unser höflich formuliertes Anliegen hat: „Nun, dieser Lehrer klingt nicht sehr freundlich, es ist nicht anständig, sich dir gegenüber so zu verhalten …“
Das ist so wichtig, weil zu viele Beziehungen daran scheitern, dass jemand seine Sprache verloren hat. Es gibt eine Grenze, wie lange wir still leiden können, bevor die Liebe erlischt. Wir können nicht ewig Sex haben, der uns unangenehm ist, bevor wir ihn ganz ablehnen. Wir können nicht segeln, bis wir unser Gegenüber dafür verachten, was es uns durchmachen lässt. Wir müssen die Probleme angehen, solange noch guter Wille vorhanden ist.
Wir können glauben, dass wir eine Beziehung beschädigen können, indem wir „schwierig“ sind. Dass wir, um ein guter Partner zu sein, nicht zu viele Bedürfnisse einbringen sollten.
Aber mit der Zeit erkennen wir, dass das wahre Problem darin besteht, nicht zu wissen, wie man seine Bedürfnisse in einer Beziehung zum Ausdruck bringt. Wir dürfen so kompliziert sein, wie wir sind – wir sollten nur versuchen zu erklären, wie die Welt durch unsere Augen aussieht. Wir müssen keine „normalen“ Schlafgewohnheiten, keinen „normalen“ Geschmack in Sachen Sex und keine „normalen“ Ansichten über Tiere haben. Was wir brauchen, ist die Fähigkeit, andere Menschen in unsere Welt mitzunehmen, damit sie verstehen können, dass wir gleichzeitig gute Menschen und andere Menschen sind. Wir brauchen die tiefe Überzeugung, dass es durchaus möglich ist, wir selbst zu sein und geliebt zu werden, solange wir freundlich miteinander sprechen. Und dass wir nichts weniger akzeptieren – weder von der anderen Person noch von uns selbst.