H. Shmuel Erlich
Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen’ – (Genesis 2:18)
Die Erleben der Einsamkeit ist ubiquitär. Sie erscheint häufig als klinisches Problem. Das Wesen und die Bedingungen der Einsamkeit sind ein oft diskutiertes Thema in Literatur, Philosophie und Soziologie und vor allem in existentialistischen Abhandlungen. Ihr
Stellenwert für die Psychoanalyse ist allerdings weniger klar. Die psychoanalytische Behandlung der Einsamkeit wird meistens negativ definiert oder als die Abwesenheit von etwas Positivem charakterisiert: als Mangel von Anwesenheit des anderen oder als
Unfähigkeit, diese Abwesenheit zu ertragen und allein zu sein. So schreibt Quinodoz (1993), daß „auf dem Boden der Angst vor Einsamkeit die seit der Kindheit ungelöste Trennungsangst liegt.“ Einsamkeit mit Trennung und Objektverlust gleichzusetzen,
scheint mir mit spezifischen Annahmen über die Natur der Objektbeziehung einherzugehen, die einen großen Teil heutiger psychoanalytischer Theorie charakterisieren. Ich werde zu zeigen versuchen, daß diese Annahmen in die Irre führen. Da sie nur die halbe Geschichte erzählen, können sie nur als halbe Wahrheit gelten.

Conny Habbel – Die Spiegelung der Echo
„Auch Conny Habbel erzählt in ihrer fünfteiligen Fotocollage Echo and Narcissus (2006) die Geschichte von Liebe und Begehren neu und bezieht sich dabei auf die dramatische Version des Mythos, die der zu den Präraffaeliten zählende John William Waterhouse 1903 gemalt hat. Indem Conny Habbel in das Geschehen ,eingreift‘ und ganz im Sinne heutiger Konfliktlösungsversuche neu erzählt, instrumentalisiert sie zugleich die starken Emotionen, mit denen Waterhouse seinen Narziss geschildert hat und die seine Darstellung aus dem üblichen Wiedergabeschema am Ende des 19. Jahrhunderts herausragen lässt“ (Welsch in Ermacora/Welsch 2012: Der Spiegel des Narziss – Vom mythologischen Halbgott zum Massenphänomen, S.30).
Die klinisch zentrale Bedeutung der Einsamkeit wurde bisher in der
psychoanalytischen Literatur nicht bedacht. Einsamkeit wird im Gesamtwerk Freuds kaum und nur in Verbindung mit Kindheitsphobien und -ängsten erwähnt (1916-17a, 422; 1926d, 201; 1933a, 89). In späteren Veröffentlichungen hat Cohen auf den Zusammenhang von Einsamkeit, Alter und Tod aufmerksam gemacht (1982). Frieda Fromm-Reichmann (1959) und Melanie Klein (1963) haben sich bemerkenswerterweise diesem Thema in ihren letzten
Schriften zugewandt. Jenseits der phänomenologischen Beschreibung bleibt die Bedeutung von Einsamkeit jedoch ein Rätsel.

„Conny Habbel setzt in ihrer Abfolge bei Nummer eins mit der Blume, „in der Mitte safrangelb und umsäumt mit weißen Blütenblättern“, ein. Das heißt, sie beginnt mit dem Ende bei Ovid, denn Narcissus stirbt, jedoch finden die Naiaden und Dryaden anstelle des Leichnams eine ebensolche Blume, die mithin für den Tod steht. In der folgenden Intervention ersetzt sie die gemalte Echo mit einem zeitgenössischen Foto, um im Weiteren die Position des Narcissus einzunehmen. Entsprechend sind in der Folge die beiden in ihrem Geschlechterkampf auseinanderdividiert. Im Abschlussbild sieht Echo nicht einmal mehr auf Narcissus, sie konnte sich – im Gegensatz zum antiken Mythos – von ihm lösen. Die Künstlerin hat damit den Schwerpunkt der Tragik verschoben.“ (Neuwirth in Ermacora/Welsch 2012: Der Spiegel des Narziss – Vom mythologischen Halbgott zum Massenphänomen, S.87).
Die Behandlung von Beziehungsstörungen ist gewöhnlich sehr schwierig, da sie Deutungen im klassischen Sinn nicht zugänglich sind. Fortschritt findet über Wege statt, die nicht einfach be- oder umschreibbar sind. Verschiedene Autoren haben dieses Thema
von zahlreichen Gesichtspunkten aus in Angriff genommen. Den verschiedenen Konzeptualisierungen scheint eine zugrundeliegende Überzeugung gemeinsam zu sein: die Patienten, von denen hier die Rede ist, benötigen mehr als andere die Erfahrung einer besonderen Atmosphäre, die mehr bewirkt als das klassische Ziel „Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten“ (Freud, 1914g) der früheren symbolisierten und verdrängten Erfahrungen. Diese Patienten sind in besonderer Weise zielstrebig und unerbittlich in dem
Bemühen, solch eine Atmosphäre durch eine Vielzahl komplexer, weitgehend nichtverbaler, intensiver projektiv-introjektiver Prozesse herzustellen. Sie scheinen eine gewisse zusätzliche Qualität im Hier und Jetzt des Behandlungszimmers zu brauchen, um
notwendige Bedingungen für weiteres seelisches Wachstum bereitzustellen, was dann mit der Zeit mehr klassische psychoanalytische Arbeit erlauben mag.

Der Mythos von Narziss und Echo
Wenn wir uns auf den Mythos besinnen, werden viele verschiedene Erklärungen angeboten (Wieseler 1856, zit. n. Modena 1981).
Am bekanntesten ist die Version von Ovid (Ovidius 1982) in den Metamorphosen III, bei der Narziß, als Sohn der vom Flussgott Kephissos vergewaltigten Nymphe Leiriope, sich selbst in seinem Spiegelbild erkennt, in das er verliebt war, und gemäß einer Prophezeiung des Teiresias stirbt und zur Blume (Narzisse) wird.
Weniger bekannt ist, daß etymologisch (n. Kluge 1975) die Blume dem Mythos den Namen gegeben hat und wegen ihres betäubenden Dufts mit narkotisch, starr und gelähmt werden in Zusammenhang steht. Hieraus entstand „narcissos“ bei Homer und „narcissus“ bei Vergil. Insofern erscheint es nicht zu weit hergeholt, den Mythos des Narziss mit der Abtötung oder Narkotisierung eigener unerträglicher Gefühle über fehlende Wahrnehmung und Spiegelung durch die primären Objekte in Verbindung zu bringen, Narzissmus also als Restitutionsversuch zur Herstellung von Kohäsion (Kohut 1971) bzw. als Abwehrstruktur (Kernberg 1975) zu verstehen.
Im Bemühen, diese zusätzliche Qualität oder Dimension zu konzeptualisieren, bin ich zu einem Verständnis gekommen, das die Rolle des Erlebens selbst und im besonderen die intrapsychische Qualität des Erlebens von Subjekt und Objekt am Kontinuum von Sein und Tun (Erlich & Blatt, 1985) entlang betont. Mein Verständnis richtet sich auch auf zwei wichtige, daraus resultierende Folgen: wie gut Analytiker und Patient zusammenpassen und wie die Sein-Bezogenheit des Analytikers im Behandlungsprozeß verfügbar ist (Erlich, 1988, 1991). Ein besseres Verständnis der Einsamkeit sollte uns helfen, unseren theoretischen Zugriff auf das Phänomen der Beziehung zu vertiefen und unsere technischen Fähigkeiten mit den Patienten zu erweitern.
Einsamkeit im Mythos und in der Psychoanalyse
Einsamkeit ist die andere Seite des Januskopfs der Beziehung. Zum Menschsein gehört in der Tat die Einsamkeit nicht weniger als seine Beziehungen. Wie immer liefern Mythos und Legende reichlich Anschauungsmaterial für das Verständnis der vom Wesen her
dualistischen Natur der Einsamkeit. Während z.B. ein Gefühl der Vollständigkeit und Zufriedenheit in der gesamten Schöpfungsgeschichte, wie sie im biblischen Text überliefert ist, auffällt: „Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut“ (1. Mose 1, 31), taucht eine wesentliche Duplizität in der Weise auf, in der der Mensch betrachtet wird. Einerseits ist er in sich und für sich völlig vollständig erschaffen — unabhängig, für sich und autonom. Aber zur gleichen Zeit erscheint er unvollständig,
angewiesen auf äußere Aufwertung und Ergänzung, um seiner wesentlich zu ihm gehörigen psychischen Bedürftigkeit zu entfliehen. Unmittelbar nach der Warnung an den ersten Menschen vor der Gefahr, die im Wissen besteht und zum Tod führen kann (Essen
vom Baum des Lebens und der Erkenntnis), bemerkt der Schöpfer, daß dem Menschen etwas fehlt: „Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei“ (1. Mose 2, 18). Das Heilmittel folgt unmittelbar: „Ich will ihm eine Gehilfin machen“. Die
Schöpfung Evas, die Frau als Kameradin oder „Gehilfin“, korrigiert die Unvollkommenheit des Menschen im Alleinsein. Doch während der Schöpfungsmythos den Menschen ursprünglich für sich selbst geschaffen beschreibt und ihn innerhalb der Schöpfung
wesentlich allein sieht, ist es bemerkenswert, daß das fünfte Kapitel der Genesis einen anderen, konkurrierenden Schöpfungsmythos anbietet, in dem dieses zentrale Problem umgangen wird: „Da Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes; und
schuf sie einen Mann und ein Weib und segnete sie und hieß ihren Namen Mensch zur Zeit, da sie geschaffen wurden“ (1. Mose 5, 1-2). Wie wir sehen werden, bringen diese beiden Versionen der Erschaffung des Menschen eine tiefe psychologische Wahrheit über die grundlegende menschliche Natur zum Ausdruck.

Von Anfang an also kann Einsamkeit als ein fundamentaler menschlicher Charakterzug angesehen werden, der mit dem Problem der Vollkommenheit verwoben ist. Der biblische Mythos selbst scheint das Thema zu benennen: Unter welchen psychologischen
Bedingungen ist Alleinsein der Höhepunkt der Schöpfung und Existenz, ein Zustand von Vollkommenheit und Vollständigkeit, der nichts darüber hinaus erfordert? Und wann ist es
ein Eingeständnis von Schwäche und Unvollkommenheit?
In der letzten Fassung seiner Triebtheorie zog Freud die Legende in Platons Symposion heran. Darin waren die ursprünglichen menschlichen Wesen gleichzeitig männlich und weiblich, bis Zeus entschied, „jeden Menschen in zwei Teile zu teilen, ‚wie man die
Quitten zum Einmachen durchschneidet‘ … Weil nun das ganze Wesen entzweigeschnitten war, trieb die Sehnsucht die beiden Hälften zusammen: sie umschlangen sich mit den Händen, verflochten sich ineinander im Verlangen, zusammenzuwachsen‘ (1920g, 62). Der „ursprüngliche Zustand“ ist wiederum durch Ganzheit gekennzeichnet, deren Vollkommenheit daher rührt, daß das Selbst alles enthält und nichts von außen braucht.
Dieser Zustand kann jedoch nicht immer währen. Eine göttliche Einmischung veranlaßt das Selbst zu einer inneren Trennung und zur Sehnsucht nach der verlorenen anderen Hälfte. Im „ursprünglichen Zustand“ ist das Ich mathematisch exakt allein, jedoch in einer Weise, in der es nicht die Sehnsucht nach etwas erfahren kann, denn es enthält alles. Es ist beides, Subjekt und Objekt. Später kann das Ich sich wieder als allein erfahren. Aber jetzt ist das Alleinsein durchflutet von Einsamkeit mit dem Bewußtsein des Verlustes eines Teils von sich selbst und mit dem Verlangen und der Sehnsucht danach. Freud
setzte diese Gefühle mit dem Verlangen des Eros und demnach mit dem Ursprung der Objektliebe gleich.

Ovid (1983) hat in seinen Metamorphosen diesen Mythos in Worte gefasst und in wunderbarer Sprache beschrieben. Ich will nun versuchen, den Mythos in den wesentlichen Punkten darzustellen:
Narziss ist ein schöner, körperlich vollkommener junger Mann, „begehrt von Jünglingen und Mädchen“, der jagend durch die Wälder streift. Als die Nymphe Echo Narziss erblickt, verliebt sie sich sofort in ihn. Juno, die Gattin des Jupiter, hat sie jedoch verdammt, niemals von sich aus jemanden ansprechen zu können, sondern nur die Worte des Gehörten wiederholen zu müssen. Dieser Fluch kam auch in der Begegnung mit Narziss schicksalshaft zum Tragen.
Echo „tritt heraus aus dem Walde, eilt, um den Hals, den ersehnten, die Arme zu schlingen“. Doch jener flieht und ruft im Fliehen:
„Nimm weg von mir deine Hände! Eher möchte ich sterben, als dass ich würde dein Eigen!“ Die Nymphe zieht sich im Schmerz des Verschmähtseins in die Wälder zurück. Schliesslich sind nur noch Stimme und Knochen übrig. Die Stimme blieb, die Knochen sind, so erzählt man, zu Steinen geworden. Seitdem hält sie im Wald sich versteckt. „Was in ihr noch lebt, ist der Klang nur“.
Narziss kommt an eine Quelle, aus der er trinken will. Dabei sieht er sein Spiegelbild, in das er sich sofort verliebt; jedoch als sein Spiegelbild zunächst nicht erkennt. In Liebe entflammt, möchte er den wunderschönen Jüngling, den er im Wasser sieht, berühren und liebkosen. Doch immer, wenn er ins Wasser greift, verzerrt sich das Bild des Geliebten. Nach wiederkehrenden schmerzlichen Versuchen, den Jüngling in der Quelle zu begreifen, erkennt Narziss schliesslich:
„Der da bin ich! Ich erkenne! Mein eigenes Bild ist’s! In Liebe brenn ich zu mir, errege und leide die Flammen! Was tu ich? Lass ihn mich bitten? Was sollte ich dann auch erbitten? Was ich begehre, ist an mir! Es lässt die Fülle mich darben. Könnte ich scheiden von meinem Leibe! Oh neuer Wunsch eines Liebenden: Wäre – so wollt ich – fern, was ich liebe! Und schon nimmt der Schmerz mir die Kräfte, es bleibt mir nicht lange Zeit mehr zu leben, ich schwinde dahin in der Blüte der Jahre. Schwer ist der Tod nicht mir, der mit ihm verliert seine Schmerzen: Er, den ich liebe, ich wollte, dass Er beständiger wäre“.
„Jetzt, jetzt sterben vereint in einem Hauche wir beide!“ Nach der Darstellung von Ovid vergeht Narziss zunehmend in seinen Schmerzen. Nach einer anderen Version hat sich Narziss einen Dolch in die Brust gestossen (von Ranke-Graves, 2005). Echo hat Narziss nicht vergeben, nur die Worte: „Wehe, wehe“ und „oh Jüngling, Geliebter, lebe wohl“, klangen dem Toten noch nach. Echo lebt in den Berghöhlen, Narziss als gleichnamige Blume weiter.
(aus: Mitterauer, Bernhard J. (2009). Narziss und Echo – Ein psycho-biologisches Modell der Depression)
Nachfolgende psychoanalytischen Theorien nahmen einen ähnlichen Standpunkt ein. Margret Mahler (Mahler et al., 1975), sah als den „ursprünglichen Zustand“ die symbiotische Phase. Separation und Individuation sind gleichbedeutend mit dem „Durchschneiden der Quitten“ und ziehen Einsamkeit, Verlust und Sehnsucht nach sich.
Obwohl die Trennung die nachfolgende Entwicklung der frühen kindlichen funktionellen Koordination und Affekteinstimmung ermöglicht und zum großen Teil dadurch geheilt wird, gibt es nie mehr eine vollständige Rückkehr zum Glück und zur Wonne, die der
symbiotischen Phase zugeschrieben wird.
Vielleicht gibt die der symbiotischen Phase zugeschriebene Wonne ein romantisches Bild dieser Entwicklungsphase wieder. Doch die Tendenz, die früheste, „paradiesische“ Zeit des Lebens zu romantisieren, mag selbst ein bezeichnender Aspekt der Frage sein,
die wir untersuchen. Die Einsamkeit, die wesentlich zum Menschen gehört, wird verleugnet, wenn ein „verlorengegangener“ Zustand, dem dieses Erleben fremd ist, postuliert und somit auch angestrebt wird.
Das psychoanalytische Bild jedoch ist noch komplexer. Freud handelte das Thema der Beziehung auf zwei Ebenen ab: als eine von außen gegebene oder phänomenologische Tatsache und als einen metapsychologischen Abkömmling seiner Triebtheorie. Der frühen psychosexuellen Entwicklung fehlt ein wirkliches Objekt, sie ist autoerotisch.
Dennoch bezieht sich der Säugling auf ein reales äußeres Objekt – die Brust -, das er verliert und wiederfinden muß. Später bezeichnete Freud (1914b) das Ich (mit der Bedeutung von „man selbst“ oder „Selbst“) als das große Reservoir der Libido und führte außerdem den Narzißmus als paradoxe, problematische und umstrittene Lösung der Frage ein, wo denn die erste Objektbeziehung ihren „Platz“ habe . Wie Melanie Klein (1952) richtig bemerkte, rief dieses Paradoxon einen grundlegenden Widerspruch in der Psychoanalyse hervor zwischen der Sicht, daß der Narzißmus ein unabhängiges
Entwicklungsstadium ist, das den Objektbeziehungen vorausgeht und die Möglichkeit eines früheren objektlosen Zustandes einbezieht (und damit auch die Möglichkeit, auf einen solchen objektlosen Zustand zu regredieren), und der Sicht, daß der Narzißmus ein
besonderer Zustand oder eine besondere Qualität der Beziehung zu einem Objekt darstellt, die mit anderen Weisen des Sich-Beziehens sowohl zusammen auftritt, als auch eine Alternative zu diesen darstellt.

Die Perspektive von ECHO kommt in der folgenden Version besonders gut zur Geltung – ECHO (als Gegensatz zu RESONANZ) wird für diese Arbeit hier noch grosse Bedeutung erlangen:
„Narziss ist ein schöner, körperlich vollkommener junger Mann, begehrt von Jünglingen und Mädchen, der jagend durch die Wälder streift. Als die Nymphe Echo Narziss erblickt, verliebt sie sich sofort in ihn. Juno, die Gattin des Jupiters, hat sie jedoch verdammt, niemals von sich aus Jemanden ansprechen zu können, sondern nur die Worte des Gehörten wiederholen zu müssen. Dieser Fluch kam auch in der Begegnung mit Narziss schicksalhaft zum Tragen.
Echo tritt heraus aus dem Walde, eilt, um den Hals, den ersehnten, die Arme zu schlingen.
Doch jener flieht und ruft im Fliehen: Nimm weg von mir deine Hände! Eher möchte ich sterben, als dass ich würde dein Eigen! Die Nymphe zieht sich im Schmerz des Verschmähtseins in die Wälder zurück. […] Narziss kommt an eine Quelle, aus der er trinken will. Dabei sieht er sein Spiegelbild, in das er sich sofort verliebt, jedoch als sein Spiegelbild zunächst nicht erkennt. In Liebe entflammt, möchte er den wunderschönen Jüngling, den er im Wasser sieht, berühren und liebkosen. Doch immer, wenn er ins Wasser greift, verzerrt sich das Bild des Geliebten. Nach wiederkehrenden schmerzlichen Versuchen, den Jüngling in der Quelle zu ergreifen, erkennt Narziss schließlich: Der da bin ich! Ich erkenne! Mein eigenes Bild ist’s! In Liebe brenn ich zu mir, errege und leide die Flammen! […] Oh neuer Wunsch eines Liebenden:
Wäre – so wollt ich – fern, was ich liebe! Und schon nimmt der Schmerz mir die Kräfte, es bleibt mir nicht lange Zeit mehr zu leben, ich schwinde dahin in der Blüte der Jahre.
Schwer ist der Tod nicht mir, der mit ihm verliert seine Schmerzen: Er, den ich liebe, ich wollte, dass er beständiger wäre. Jetzt, jetzt sterben vereint in einem Hauche wir beide!“ (zitiert nach Mitterauer (2009 S.31).
Weiter heisst es in Mitterauers Depressions(!)-Buch (S.32f):
„Echo hingegen hat die Intention, Narziss in Liebe zu umarmen, ist aber unfähig, aktiv mit ihm Kontakt aufzunehmen, muss bruchstückhaft wiederholen, was Narziss aus seiner subjektiven Welt von sich gibt. Sie leidet sehr darunter, muss aber die Nichtmachbarkeit jedweder Kommunikation mit Narziss akzeptieren. Gleich dem Narziss hält Echo an der Nichtmachbarkeit ihrer Intention nach Begegnung beharrlich fest, bis sie daran zugrunde geht. So gesehen verhält sich auch Echo hyperintentional und verliert wie Narziss durch dieses Verhalten völlig das Selbstverständnis. Die beiden unterscheiden sich jedoch in ihren Handlungsstilen, sodass man von narzisstischer Verwerfung und echoischer Akzeptanz sprechen kann.
Mitterauer unterscheidet „Narzisstische Verwerfung von echoischer Akzeptanz“ und verfolgt damit eine Dialektik ähnlich der hier dargelegten und ähnlich derjenigen von z.B. Wink oder auch Joffe und Sandler (s.u.).
Wenn die Hauptströmung in der Psychoanalyse dazu neigt, Objektbeziehungen und eine bestimmte Form der Triebtheorie als unteilbar zu betrachten, dann erscheint Einsamkeit als eine Funktion des Ausmaßes, in der Triebe eine äußere Ergänzung als Teil ihres Ziels
und ihrer Erfüllung brauchen. Da die Wunscherfüllung oder Wunschbefriedigung im Entladen der Triebspannung, die zur Bindung an das Objekt führt, kulminiert, muß die Erfüllung des Wunsches zu einem Erlebnis führen, in dem das Verlangen sich erschöpft hat oder zu einer Abnahme des Objektbegehrens (ähnlich dem Rückzug nach dem Klimakterium) führt. In Verbindung mit dem Objektverlust führt in der Triebtheorie die Beziehung zum Objekt zu einer Ansammlung depressiver Affekte, von denen Einsamkeit
nur ein Teilgefühl ist. Ein solches Modell der Beziehung zwischen Selbst und Objekt läßt einen weniger an etwas Dauerhaftes denken, sondern führt einen eher zu dem Bild von Ebbe und Flut, zu einer Qualität der Beziehung, die im Zusammenhang mit Gehen und
Wiederkehr von Trieb und Begehren steht und fällt. Dieses Thema wird gewöhnlich umgangen durch die Annahme einer „präexistierenden“, bedeutsamen Verbindung oder Beziehung (Freuds „anaklitisches“ Modell) zwischen dem Triebsubjekt und dem
Triebobjekt. Je einzigartiger und bindender die Beziehung ist, so wird geglaubt, desto abhängiger wird das Triebsubjekt und desto wahrscheinlicher wünscht es sein Objekt herbei und fühlt sich ohne es einsam. Dies wirft jedoch die Frage auf, ob es eine Tendenz
zu einer Beziehung (oder Bindung) gibt, die aus einer Quelle gespeist wird, die unabhängig von der Besetzung des Objektes durch den Trieb ist.
Die kleinianische Ansicht, daß Objektbeziehungen, wenn auch nicht hochkomplex, von Beginn der postnatalen Existenz an existieren (Klein, 1952), besteht nichtsdestoweniger darauf, Objektbeziehungen mit triebhaften Vorgängen, die durch das Wechselspiel von
Projektion und Introjektion vermittelt werden, gleichzusetzen. Und die Ansichten, die allgemein als dem klassischen Standpunkt vollkommen entgegengesetzt eingeschätzt werden, wie ursprünglich von Fairbairn (1952) und Bowlby (1969) geltend gemacht, gehen
von einem Trieb aus, der das Objekt sucht, und von einem damit verknüpften Bedürfnis nach Bindung.
Die Auffassung, die den Trieben eine zentrale intrapsychische Stellung zuspricht, sieht Einsamkeit als eine Funktion des triebdominierten Verlangens nach dem Objekt. In dem Ausmaß, wie dieses Objekt oder ein anderes abwesend, nicht existent, nicht verfügbar oder säumig ist, werden Schmerz und Unlust gespürt. Worauf es aber besonders ankommt: all dieses Verlangen hat im Grunde das Ziel, den Wunsch zu befriedigen und die Entladung der Triebspannung zu ermöglichen. Eine solche Verbindung mit dem Objekt ist als wesentlich narzißtisch einzustufen. Dies wurde klar von Annie Reich (1953) erkannt, als sie sagte, daß in der prägenitalen Sexualorganisation die Objekte eigennützig zur eigenen Befriedigung gebraucht werden, so daß die Entscheidung, „ob wir ein solches Verhalten als auf prägnitalem Niveau fixiert, als Objektbeziehung oder als narzißtisch bezeichnen, eine Frage der Terminologie ist.“ Diese Schlußfolgerung jedoch zeigt die Unschärfe, das Zirkuläre und den fraglichen Nutzen des Narzißmuskonzepts, wie es ursprünglich formuliert wurde.
In der klassischen Theorie stellt der Narzißmus den Gegenpol zum Angewiesensein auf ein (externes) Triebobjekt dar. Die narzißtische Position ist die Kehrseite der triebdominierten Bedingung: während der Trieb ein Verlangen nach dem Objekt schafft und zu der Fähigkeit führt, die Erfahrung der Abwesenheit des Objekts durch
Internalisierung und symbolische Transformation zu denken, ist Narzißmus die Verneinung dieses Bedürfnisses. Für den Narzißten ist der Zustand unerträglich, in dem er seine Unvollständigkeit und Selbstbegrenzung, die von solchen Bedürfnissen und
Notwendigkeiten herrühren, unausweichlich erlebt. Er findet diese Bedürfnisse dermaßen unerträglich, daß er sich selbst in eine Position begibt, in der er die anderen entweder fast überhaupt nicht braucht oder das Erlebnis des Bedürfnisses abscheiden oder abspalten
kann. Der Narzißt schafft um sich herum eine Art Blase oder Sphäre, in der er alles hat und in der alles, was er sich vorstellen kann, schön, gut, bewundernswert oder anbetungswürdig ist. Er ist nur insofern auf den anderen angewiesen, als dieser ihm sein eigenes Sein bestätigt, ihm als Spiegel dient und ihm die eigene Werthaftigkeit, Größe, Schönheit oder andere anbetungswürdige Eigenschaften widerspiegelt, vielleicht sogar vergrößert. Je mehr der Narzißt diese wünschenswerten Eigenschaften tatsächlich besitzt, desto weniger wird er sich von anderen abhängig fühlen oder sie zu seiner
Ergänzung zu brauchen. Letztlich entwertet seine Selbstgenügsamkeit wirkungsvoll die Objektbeziehungen und die Fähigkeit, die für die Symbolisierung notwendige Ab- und
Anwesenheit wirklich zu denken (Green, 1975).
Die klassische psychoanalytische Theorie sieht Objektbeziehungen und Narzißmus als einen Gegensatz an und, obwohl sie normalen von pathologischem Narzißmus unterscheidet3, betrachtet den Narzißmus als Regression, Abwehr und Entwicklungsdefizit. Die narzißtische Persönlichkeit ist unfähig, wirklich mit jemandem in
Beziehung zu sein oder zu kommen, weil sie unfähig ist, den anderen libidinös und emotional zu besetzen. Ob er nun augenblicklich allein ist oder nicht, der Narzißt hat sich gegen das Erleben der Einsamkeit immunisiert: der Anschein, den er sich gibt, ist eine Abwehr gegen das Erleben der Bedürftigkeit und Einsamkeit. Zur selben Zeit jedoch gibt es eine zugrundeliegende, implizite, unausgesprochene Annahme, daß, ungeachtet aller Anstrengungen in Richtung Unabhängigkeit und Selbstgenügsamkeit, der Narzißt sich eigentlich heftig nach Beziehung, Liebe und Nähe sehnt und das nicht weniger, sondern vielleicht sogar mehr als andere. Diese besondere Sicht, die von einigen Exponenten der britischen Schule der Objektbeziehungen vertreten wird, findet seinen klarsten und eloquentesten Ausdruck in Fairbairns (1952) und Guntrips (1969, 1971) Schriften über schizoide Zustände. Darin werden das Streben nach Nähe und Beziehung und seine nahezu völlige Vermeidung als ein Ankämpfen gegen die Angst vor der eigenen Liebe verstanden, die sich in überwältigender Gier und zerstörerischem Hunger nach einem Objekt zeigt und zu tragischer Isolation und Einsamkeit führt. Kohut (1977) bezog sich ähnlich auf die narzißtische Persönlichkeit als tragischen Menschen.
3 Obwohl es verlockend ist, zwischen gesundem und pathologischem Narzißmus zu unterscheiden, erfordert der Versuch einen übermäßigen theoretischen Aufwand und würde, so steht zu befürchten, in einer tiefgehenden Analyse das Thema nicht wirklich klären. Ich neige dazu, Eagles Meinung zu akzeptieren: „Statt von gesundem Narzißmus zu sprechen, … ist es weniger verwirrend zu sagen, daß die Entwicklung eines grundlegenden Gefühls der Unversehrtheit, der Selbstschätzung und des Selbstwerts dazu führt, vorherrschend narzißtische Motive als organisierende Parameter für Verhalten und Beziehungen aufzugeben (1984, 56).
Die Untersuchung der Erlebnisdimensionen, die der Objektliebe und der narzißtischenObjektwahl innewohnen, führte zu einem tieferen Verständnis der klinischen, therapeutischen und theoretischen Sachverhalte, präsentiert zunächst von Patienten mit erweiterter Indikation, inzwischen von den meisten, denen wir heutzutage begegnen. Die Fragestellungen, die von der Notwendigkeit herrühren, Triebe, Objektbeziehungen und intersubjektive Erlebnisse zu integrieren, wurden von vielen Psychoanalytikern beschrieben und bedacht. Ich habe mein eigenes Verständnis in Begriffen eines Modells formuliert, das in den Mittelpunkt psychischen Funktionierens den Prozeß des Erlebens stellt, der durch zwei dafür verantwortliche Modalitäten vermittelt wird. Ich stelle die
wichtigsten Fundamente dieses Modells vor, um ihre Implikationen der Einsamkeit und des Narzißmus zu untersuchen.

Der Maler Caravaggio: Bild „Narziss“ um 1596
„Das berühmte, Caravaggio (1571-1610) zugeschriebene, fast quadratische Gemälde, wohl ein Frühwerk (um 1595-1597), zeigt nur den suchenden Narziss, das Wasser und – was auch beim ,Waldtypus‘ häufig fehlt – sein Spiegelbild, der Rest ist Dunkelheit. Dieser Narziss, der lange Jahre so gut wie unbeachtet blieb, bildet – wahrscheinlich zusammen mit der fast 350 Jahre später entstandenen ‚Metamorphosis of Narcissus‘ (1937) von Salvador Dali (1904-1989) – die für das heutige Verständnis entscheidende und sicherlich zugleich bekannteste bildnerische Darstellung des Mythos. Vermutlich hatte sich Caravaggio inhaltlich ‚zu genau‘ an Ovid orientiert, die innige Verbindung von Narziss und seinem Spiegelbild fand zur Zeit seiner Entstehung keine Nachahmer, überdies wurde sein Aeusseres als grobschlächtig abgelehnt. Erst mit der Kenntnis von Freuds Theorien des Narzissmus begann man zu verstehen, dass Caravaggio mit diesem Gemälde seiner Zeit weit voraus gewesen war und sein Narziss, wie die Menschen der Moderne, Selbsterfahrung suchte“ (Welsch in Ermacora/Welsch 2012: Der Spiegel des Narziss – Vom mythologischen Halbgott zum Massenphänomen, S.20-22).
Erlebnis-Modalitäten von Sein und Tun
Der Strom unseres Erlebens entspringt den Sinneswahrnehmungen, den Daten sensorischer Aufnahmen und Eindrücke, und führt zu psychischen Schemata, in denen das Erleben organisiert und strukturiert wird. Zwischen diesen Polen – einfachen Sinnesdaten
und einer inneren strukturierten Welt – geht alles in das psychische Erleben ein, sei es bewußt oder unbewußt, sei es der inneren oder äußeren Realität zuzuordnen. Es ist Gegenstand einer Entwicklung entlang zweier Dimensionen oder Modalitäten, die sowohl
angeboren als auch sozial geformt sind und die unser Erleben fortwährend und unaufhörlich verdauen, assimilieren und strukturieren. Auf dieses äußerst wichtige Feld eines Erlebnisprozesses, der überwiegend außerhalb des Bewußtseins und willentlicher Kontrolle abläuft, beziehe ich mich in den Modalitäten des Erlebens. Dieser Zwischenprozeß wurde von Freud schon früh in dem ‘Entwurf einer Psychologie’ (1950c, 403-410) postuliert. Ähnlich bezieht sich Bion auf ihn mit der „Alpha-Funktion, [deren Aufgabe es ist,] Sinnesdaten in Alpha-Elemente zu konvertieren und somit die Psyche mit dem Material für Traumgedanken und entsprechend mit der Fähigkeit, aufzuwachen oder einzuschlafen, bewußt oder unbewußt zu sein, versorgt…“ (1967, 115).
Ausgehend von Winnicotts Formulierungen (1971, 130) habe ich eine
Rahmenkonzeption entwickelt, in der die Dimensionen Sein und Tun parallele und komplementäre innere Spuren bilden, in denen Erleben hergestellt und organisiert wird.
Die inneren Spuren habe ich neu benannt als Erlebnis-Modalitäten von Sein und Tun (Erlich, 1991). Immer sind es beide Modalitäten, die die erlebte Beziehung von Subjekt und Objekt herstellen und das Gebiet der Objektbeziehungen umfassen. Es gibt jedoch signifikante
Differenzen in der Art und der Qualität, wie die Beziehung von Selbst und Objekt, durch diese zwei Modalitäten hergestellt und erlebt wird.
In der Modalität des Tunswerden selbst und anderer als getrennt, unterschieden und instrumentell aufeinander bezogen erlebt: Selbst und Objekt sind klar durch Grenzen gekennzeichnet; die Beziehung zwischen ihnen ist ursächlich und bestimmt durch Zweck, Absicht, Richtung und zeitlicher Abfolge. Dies ist die Modalität, in der Triebe und Konflikte erlebt werden. Die zentrale Frage kann hier mit „wer tut wem was?“ umschrieben werden. Deshalb benannte ich diese Dimension als „Tun“. Zeit und Raum werden, wie alle anderen Komponenten, die sich gut für eine Realitätsprüfung eignen, in
dieser Beziehungsform chronologisch und realistisch erfahren. Denken gehört dem Sekundärprozeß an: es ist adaptiv und betont objektive, logisch-wissenschaftliche Ziele und Methoden. Es ist der gesamte Spannungszustand, wie er in konstruktiven und
dekonstruktiven Aktivitäten vorherrscht; es ist die Kraft hinter Aufgeben und Verzicht, die besondere Arten der Symbolisierung (z.B. mathematische) in Gang setzt. Die Gesamttendenz ist zielgerichtet und strebt Effizienz der Funktion, der Arbeit und der Fertigkeiten an. Grenzen sind von höchster Wichtigkeit: Getrenntheit und Besonderkeit von Selbst und Objekt finden ihren Ausdruck in der Klarheit, der Definition und der Strenge der Grenzen, die sie unterscheidbar machen.
In der Modalität des Seins hingegen ist die fundamentale Erlebnisqualität Identität und Fusion von Selbst und Objekt. Grenzen existieren nur, sofern sie Selbst und Objekt, gegenseitig in Zuständen von Fusion und Einheit aufgehoben, umfassen und enthalten. Sie
erlauben und gewährleisten die ununterbrochene Kontinuität des Erlebens. Zeit, Raum und andere Dimensionen physikalischer und faktischer Realität werden in völlig anderen Weisen (z.B. wie Variationen nicht-linearer Zeit) erlebt. Denken geschieht hier
typischerweise in der Weise des Primärprozesses und ist nicht auf Realitätsprüfung, Präzision und Objektivität aus. Im Gegenteil, die alles beherrschende Tendenz in der Modalität des Seins zielt gänzlich auf Subjektivität; sie zielt darauf, dem Subjekt die Erfahrung seines Fortbestehens, seiner ontologischen Kontinuität und Sicherheit zu
ermöglichen und in Verbindung und Einheit mit dem anderen zu existieren. Das zentrale Erleben ist das des Seins (von daher der Name) in Fusion und Zusammensein. Es gibt in dieser Dimension keine Konflikte oder Triebwünsche, sondern nur Erlebnisse von Sein
gegenüber Nichtsein mit Bedürfnissen, Wünschen, Sehnsüchten und den dazugehörigen Ängsten (Erlich & Blatt, 1985; Erlich, 1990).
4 Die Begriffe Sein und Tun haben ihren Ursprung und deutliche Parallelen in Winnicotts Werk (1971, 76- 100). Dennoch gibt es einige signifikante und grundlegende Unterschiede zwischen seiner Konzeption und der hier vorgelegten. Diese Unterschiede können in verschiedenen Hauptpunkte zusammengefaßt
werden: (1) Winnicott sah Sein als maßgeblich dem Tun in der Entwicklung vorhergehend an; (2) Nach Winnicotts Ansicht ist Tun nicht angeboren, sondern entwickelt sich aus dem Sein. Ich sehe in Sein/Tun parallele und komplementäre Modalitäten, die von Anfang an gegeben und interaktiv wirksam sind. Bis auf wenige Ausnahmen gewinnt keiner der beiden Modi zu irgendeiner Zeit bestimmenden Einfluß und Vorherrschaft. Andererseits werden im Laufe der Entwicklung die Veränderungen ihrer komplementären Überlappungen und Vermischungen immer subtiler und symbolfähiger. (3) Obwohl wir beide in diesen Modalitäten verschiedene Beziehungsaspekte sehen, sehe ich in Sein/Tun allgemeinere, umfassendere und
inhärente psychologische Modi, die auf (Ich) Funktion und Adaptation einwirken. (4) Winnicott verband Sein mit Weiblichkeit und Tun mit Männlichkeit. Guntrip weitete diese Unterscheidung auf mütterlich/väterlich aus (1969, 258). Ich sehe in Sein/Tun keine inhärente Verbindung zur Geschlechtlichkeit, sondern eine Wirkung über die Geschlechtsgrenzen hinweg. Dennoch sind Sein und Tun selektiven Verstärkungen durch eine Reihe von Faktoren unterworfen, von denen die Kultur das
wichtigste Beispiel und der Hauptbestandteil ist.
Erlebnisdimensionen und Varianten der Einsamkeit
Wenn wir nun Einsamkeit im Rahmen dieser zwei Erlebnismodalitäten untersuchen, können wir zwei ganz verschiedene Erlebnisse von Einsamkeit unterscheiden. Im Modus des Tuns wird das Objekt vom Selbst unterschieden und getrennt erlebt und
wahrgenommen. Das Getrenntsein ist Vorbedingung für das Verlusterleben, da alles, was eigentlich als Teil des Selbst wahrgenommen wird, nicht verlustig gehen kann. Das Erleben von Objektverlust und Sehnsucht nach dem verlorenen Objekt findet deshalb in diesem Modus statt. Nach meinem Verständnis ist Einsamkeit, die in der Modalität des Tuns erlebt wird, der mit dem Verlust und der Abwesenheit des Objekts einhergehende
depressive Affekt. Das Ich vermißt das Objekt, spürt den schmerzlichen Verlust und wünscht sich das Objekt zurück. Der Verlust des Objekts schließt eine vorhergehende Erfahrung ein, in der das Selbst es hatte oder besaß. Andererseits bezeichnet „haben“ und
„besitzen“ deutlich das Erleben des Objekts als Nicht-Teil des Selbst. Eine solches Erleben gehört demnach ins Reich des Tuns und infolgedessen wird der Verlust des Objekts auch in diesem Modus erlebt. Verlust schließt Abwesenheit oder negative Anwesenheit ein wie bei mathematisch negativen Zahlen, mit denen sich dann symbolisch handeln läßt. Somit sind Verlangen und Sehnsucht nach dem abwesenden Objekt (Green, 1975) nur im Modus des Tuns möglich, weil sie Ausdruck eines gesteigerten
Trennungsschmerzes sind und Trennung dieser Erlebnismodalität eigen ist.
Jedoch macht das Gefühl, durch die Sehnsucht mit dem abwesenden Objekt verbunden zu sein, es möglich, Hoffnung zu schöpfen, etwas tun zu können, das seine Rückkehr und sein Wiedererscheinen herbeiführt. Hoffnung wird des weiteren im Modus des Tuns als
eine mögliche Tat oder Phantasie entwickelt, die das Verlorene wiederherstellt oder erschafft. Wo Hoffnung ist, besteht aber auch die Möglichkeit, Hoffnung aufzugeben und Verzweiflung zu erleben. Hoffnung und Verzweiflung werden gegebenenfalls zusammen
im Trauervorgang durchgearbeitet mit den ihm innewohnenden intrapsychischen, dynamischen und strukturbildenden Verästelungen. Die „Wiederfindung des Objekts“ (Freud, 1905, 123) findet wahrscheinlich auf einem von zwei möglichen Wegen statt:
entweder wird die Beziehung mit demselben Objekt wiederbelebt oder es wird durch Trauerarbeit die Möglichkeit zu neuer Objektfindung und -beziehung geschaffen (Kleins depressive Position). Während dieses Vorgangs spielt die Fähigkeit eines symbolischen Umgangs mit dem internalisierten Objekt eine hervorragende und unersetzliche Vermittlungsrolle. Es muß betont werden, daß die hier beteiligte Symbolisierung selbst
Mitwirkende im Modus des Tuns ist und das Objekt in Übereinstimmung mit den zugrundeliegenden Regeln dieser Modalität behandelt wird (also als getrennt, begrenzt usw.). Wir können die Schicksale der Einsamkeit in der Modalität Tun als folgende Abfolge veranschaulichen: Verlust – Sehnsucht – Hoffnung/Verzweiflung/Trauer – Wiederfinden des Objekts.
Es ist etwas ganz anderes, wenn wir das Erleben der Einsamkeit aus der Perspektive der Modalität des Seins sehen. Hier hat die klare Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt keinen Bestand. Selbst und Objekt werden im Gegenteil als Einheit erfahren, als vereinigt und verschmolzen, ohne klare Grenzen und Differenzierung. Da das „Objekt“ als Teil des Selbst erfahren wird, gibt es in dieser Modalität keinen Raum, Objektverlust zu erleben. In diesem Bereich paßt das Erleben von Einsamkeit nicht zum Modus des Verlusts, sondern gehört mehr zu einem Gradienten von Leere und Nichtsein, der Subjekt und Objekt ohne Unterscheidung umfaßt. In der Modalität des Seins kann Einsamkeit sogar heftig in der physischen Gegenwart eines Objekts als das Nichtsein des Selbst zusammen mit dem Objekt erlebt werden. Was spielt es keine Rolle, ob Selbst und Objekt
im selben Raum physisch anwesend sind oder nicht. Einsamkeit als Widerspiegelung eines Fehlens im eigenen Sein ist somit ein doppeltes Erleben: die behinderte Empfindung des eigenen Seins im ontologischen Sinne als ein schreckliches Defizit der Existenz (im
Sinne von Winnicotts ‘going-on-being’) und gleichzeitig das Mißlingen des Gefühls, mit einem anderen vereint zu sein. Beide Erlebnisweisen werden durch die Modalität des Seins ermöglicht.
Das Erleben der Einsamkeit drückt sich in vielerlei Weisen aus. Allen ist jedoch gemeinsam, daß selbst dann, wenn Selbst und Objekt physisch präsent sind, das Erleben ohne Eindruck oder Resonanz bleibt. Das Gefühl ist Abwesenheit und Leere und daß aus der äußerlichen Koexistenz von Selbst und Objekt nichts zu gewinnen ist. (Man ist versucht, über dieses Erleben mit dem Begriff des Zusammenbruchs der projektiven Identifizierung nachzudenken5).
5 Die schwierige komplementäre und dualistische Natur des Erlebniskontinuums von Sein und Tun kann durch die projektive Identifizierung veranschaulicht werden. Wie viele Kleinianische Konzepte wird sie im Modus des Tuns dargestellt und gibt das grundlegende Getrenntsein von Selbst und Objekt wieder.
Doch hat die projektive Identifizierung auch am Modus des Seins teil, in dem sie eine Einheit von Selbst und Objekt durch Projektion eines Selbstaspekts in das Objekt mit einhergehender Identifizierung kreiert und dies als Selbstanteil erlebt. Diese subtile Überlappung war vielleicht verantwortlich für Meltzers Einführung einer „adhäsiven Identifizierung“ (1975) und könnte auch Ogdens Modus „autistisch berührend’“ (1989) beeinflußt haben.
Der mißlungene Seinsaspekt der tiefen Einsamkeit ist verantwortlich für das Erleben von Entfremdung, Isolation oder Dissoziation und noch mehr von Depersonalisation und Derealisation. Das Erleben wird oft beschrieben, als wäre man in einer Blase, hinter einer Glaswand oder in einem schwarzen Loch, unfähig, sich selbst oder den anderen als wirklich lebendig und anwesend zu spüren.
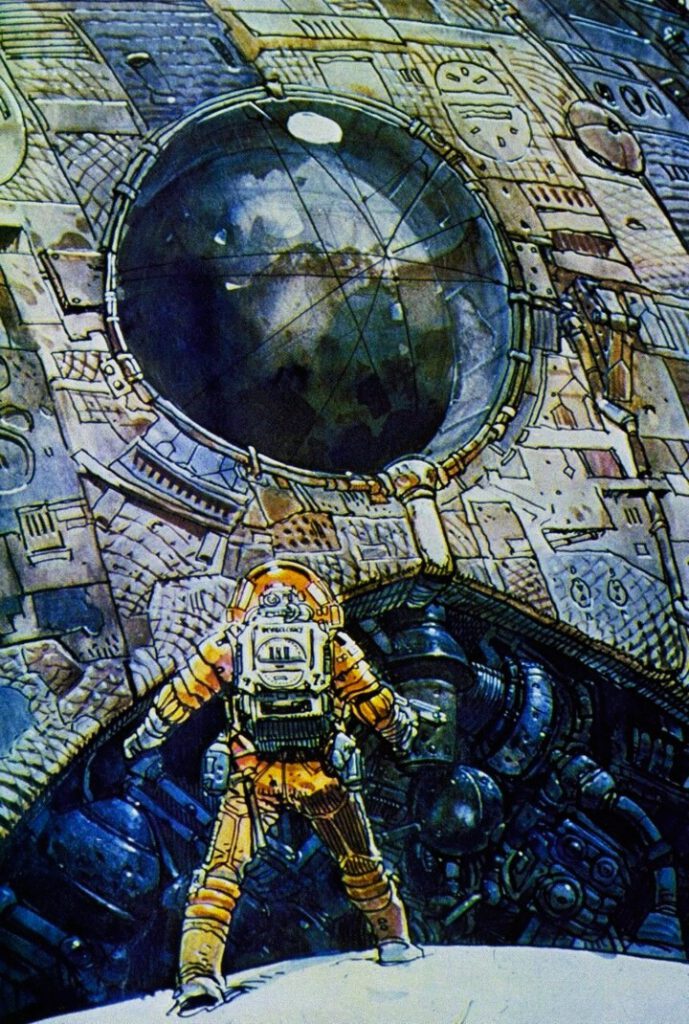
Wir sind einsam aber sicher.
Einsamkeit spiegelt in der Modalität des Seins einen Fehler im Herstellen und Aufrechterhalten der Seinsbeziehung wider. Am Seinsende des Spektrums gibt es keinen Raum für Sehnsucht – man kann sich nicht nach etwas sehnen, was sich im wesentlichen
vom eigenen Selbst nicht unterscheidet und als Teil des eigenen ‘going-on-being’ erlebt wird. Es gibt auch keine Möglichkeit, Hoffnung oder Verzweiflung zu entwickeln. Das statt dessen vorherrschende Gefühl besteht in einer Vielfalt von Erlebnissen der Leere (Apathie, Anomie, Leblosigkeit, Vitalitätsverlust, Abgeschnittensein, Zusammenhanglosigkeit, Versteinerung, nicht anwesend sein), die das erlebte Nicht-Sein widerspiegeln. An die Stelle der Hoffnung tritt im Modus des Seins als Antwort auf die
leere Einsamkeit die Illusion als ein überwältigendes Bedürfnis, fiktionale Realitäten und Überzeugungen über ein Miteinander zu schaffen, das schließlich zunichte wird, wenn es enttäuscht und unbefriedigt läßt. Es gibt nur wenig Raum oder Gelegenheit für die Wiederfindung des Objekts. Statt dessen gibt es drängende Versuche, der Einsamkeit durch vorsätzliche Handlungen und zwanghafte Aktivitäten zu fliehen, die in Wirklichkeit darauf ausgerichtet sind, den beschädigten inneren Zustand und die defizitäre Erfahrung der Beziehung von Selbst und Objekt im Sein wieder zu erschaffen oder wieder herzustellen. Häufig nimmt dies die Form und Qualität einer Sucht an, deren Objekt alles sein kann – Personen, Substanzen, Symptome oder gar die psychoanalytische Behandlung. Perversionen sind eine andere gängige Variation zwingender, gebietender Verhaltensweisen, die das „Tun libidinisieren“, um „die Leblosigkeit der inneren Welt des
Perversen zu mildern“ (Khan, 1979, 28-29). Weitere Manifestationen dieser Schwierigkeit und fruchtloser Versuche, Erleichterung zu erlangen, können bei religiöser Bekehrung
oder Entsagung beobachtet werden.
In der Sphäre des Seins tendiert Einsamkeit dazu, ein sich selbst verewigender Teufelskreis mit wenig Raum für spontane Erleichterung, Linderung und Heilung zu werden. Wir können den typischen Kreis, wie die Schicksale der Einsamkeit im Bereich
des Seins erlebt werden, wie folgt beschreiben: Leere – Konversion – Isolation und Dissoziation – Illusion und Enttäuschung – Sucht oder Perversion.
Es ist offensichtlich, daß die in der Sphäre des Seins erlebte Einsamkeit unendlich schmerzhafter und schwieriger ist als die in der Sphäre des Tuns. Es führt demnach in die Irre, die beiden Formen der Einsamkeit einfach miteinander zu vergleichen oder sie in ein
und demselben Phänomen aufgehen zu lassen. Der Mensch, der andauernd in der Modalität des Seins einsam ist, leidet an einem zunehmend bekannten Syndrom, so wenigstens in den westlichen Industrieländern (Khan, 1983b), in dessen Zentrum das Gefühl der Leere bedrohlich auftaucht, die Lücke, der tiefe Abgrund, das schwarze Loch, das weder aufgefüllt noch befriedigt werden kann. Das kann ein schlimmes und tragisches Erleben sein, besonders wegen der enormen Schwierigkeit, die in sich selbst erlebte Bedürftigkeit in Worte zu kleiden oder sie gar mit anderen zu teilen. Es ist umso verzweiflungsvoller, weil diese Form der Einsamkeit mitleiderregende Anstrengungen hervorruft, denen der Versuch gemeinsam ist, die Leere durch Rückgriff auf vermehrtes Tun zu füllen, durch den Einsatz manischer Abwehr, Erotisierung, Suchen und Finden von Stimulation und Erregung durch Alkohol, Drogen, Sex, Essen, Verbrechen oder lebensbedrohenden kontraphobischen Leichtsinn. In anderen Fällen bemerkt man Abwehranstrengungen, die von der illusionären Hoffnung geleitet werden, beschädigten oder fehlenden Beziehungen im Sein durch schonungslose Bemühungen um perfekte ästhetische Formen oder radikale
religiöse Transformationen abzuhelfen. Suchtverhalten, klassisch in den Begriffen der Terminologie des oralen Triebs, involviert auf einer tieferen Ebene einen Versuch, einen inneren Raum oder eine innere Leere durch interne oder externe Beziehungen mit Sein aufzufüllen.
Klinische Beispiele
Fall A – Frau H., eine unverheiratete Frau Ende Dreißig, physisch und intellektuell eindrucksvoll begabt, litt an einem abgrundtiefen Gefühl der Wertlosigkeit und einem lebenslangen Gefühl der Einsamkeit. Die vorrangige Qualität der Übertragungsbeziehung
in der Analyse kann dahingehend zusammengefaßt werden, daß sie mich nahezu 3 Jahre behandelte, als ob ich nicht existierte. Das war kein angedeutetes oder subtiles, noch ein nur symbolisch behandeltes Thema, vielmehr beharrte ich ziemlich offen und direkt
darauf. Sie sah mich als Instrument, ein Werkzeug zu kurativen Zwecken. Sie zahlte für meine Dienste und erwartete eine entsprechende Gegenleistung. Als ich deutete, daß ihre
Beziehung zu mir darin bestehe, sich nicht auf mich zu beziehen, konnte sie nicht verstehen, was ich meinte oder wohin solche Bemerkungen führen sollten.
Mein eigenes Gefühl in den Sitzungen bestand aus lebhaftem Interesse, sogar Faszination und einer gewissen Bewunderung für ihre Begabung. Oft jedoch war das Gefühl, ein selbstloses Werkzeug zu sein, schwer zu ertragen. Mein Erleben war weniger, mich wie tot zu fühlen, als immer wieder und pointiert dazu aufgefordert zu werden, wie tot zu handeln oder den Zwangsstatus zu akzeptieren, seelenlos, ein Ding zu sein, das sie nach ihrem Belieben gebrauchen und manipulieren kann. Solche Gegenübertragungsmuster, sich tot, nicht existent oder seelenlos zu fühlen, geben zuverlässige, spürbare Hinweise, daß es sich um Störungen in den Selbsterlebnissen und
den Beziehungen dem Kontinuum des Seins entlang handelt.
Eine der auffallenden Eigenschaften von Frau H. war ihre Einsamkeit, die nicht der Zahl ihrer Beziehungen, sondern deren Oberflächlichkeit zugeschrieben werden konnte. Sie glaubte nicht, daß irgend jemand, etwa gar ein Mann, an ihr interessiert sein oder sie begehren könnte. Als sie nach einiger Zeit in der Analyse es sich gestattete, Beziehungen mit Männern aufzunehmen, trugen diese den Charakter ihres Übertragungsverhaltens mir gegenüber, in dem die zentrale Frage lautete: „Was kann er für mich tun?“ Im dritten Jahr der Analyse ging sie eine Beziehung zu einem älteren Mann ein, einer öffentlichen Person. Sie konnte einige der exhibitionistischen und selbsterhöhenden Aspekte genießen, litt aber auch, litt vor allem unter der Tatsache, daß sie ihren Geliebten nicht vollständig und
ausschließlich beherrschte. Die Beziehung war gekennzeichnet durch große Höhen und Tiefen, dramatische Abbrüche und Versöhnungen. Meinen Deutungen in Begriffen der Übertragungsbeziehung begegnete sie mit Widerstand und ohne Einsicht.
Ich möchte die Aufmerksamkeit auf eine Sitzung aus dem dritten Analysejahr richten, in der sie über die Beziehung zu ihrem Freund sprach. Sie liebte ihn. Es war das erste Mal, daß sie ein solches Gefühl erlebt hatte, aber sie wurde von Phantasien über seine
Treulosigkeit gefoltert. Obwohl es dafür keinen Anhalt in der Realität gab, stellte sie sich dauernd vor, daß er ihr sofort untreu würde, wenn sie nicht an seiner Seite wäre, um ihn zu beobachten und auf ihn aufzupassen. Auch ihre Beziehung zu mir war in dieser Stunde
anders: es schien ihr, daß ich sie wirklich führe und unterstütze und sie wichtige Dinge in der Analyse lerne. Sie und ihr Freund waren sich so nah wie noch nie, was sich in der Abnahme ihres immensen Bedürfnisses nach Geschlechtsverkehr widerspiegelte. Er würde am Abend zu einem öffentlichen Auftritt gehen und sie war hin und her gerissen, ob sie mit ihm gehen sollte oder nicht. Wenn sie mitkäme, war es ihr, als müsse sie sich die ganze Zeit an ihn klammern und sich festhalten. Wenn sie es nicht täte, fürchtete sie, würde er mit einer anderen Frau etwas anfangen. Ich sagte: „Vielleicht brauchen Sie diese Phantasie über die andere Frau.“ Sofort veränderte sich ihre Stimme. Sie rief: was ich damit meine? Sie fühle, daß da etwas sei, sie könne es spüren! Warum ich es ihr nicht erkläre? Ihre Stimme steigerte sich rasch und erreichte eine immense Lautstärke und
wurde zum Kreischen. Ich sagte, ich hätte das Gefühl, sie schüttele mich wie einen Baum, damit die Frucht herabfalle. Sie stimmte zu und beruhigte sich etwas, aber es war mehr wie im Bergbau: man muß sehr schwer arbeiten, eine ganze Tonne ausgraben, um einige
Gramm der wertvollen Substanz zu erhalten. Sie müsse einfach wissen, was ich meine. Sie war völlig unfähig zu denken. Ich deutete ihr, sie erlebe mich als bösartig, weil ich ihr nicht Gutes, das in mir sei, liefere. Aber, sagte ich, sie auf einer anderen Ebene ansprechend: ich hielte ihre Gedanken, Vorstellungen und Gefühle für viel wichtiger als das, was ich zu sagen hätte. Sie fing sich wieder und verließ die Sitzung mit einem warmen Lächeln.
Fall B – Herr A., ein 22 Jahre alter unverheirateter Mann, kam in Behandlung, nachdem er aus einer berühmten Armee-Einheit zu einem Zeitpunkt ausgeschlossen worden war, als ihn seine Freundin verließ. Er war depressiv und narzißtisch tief verletzt. Kurz nach
Behandlungsbeginn trat er einer anderen Armee-Einheit bei, die ebenso berühmt und anspruchsvoll war, versagte aber bald wieder. Er klagte über chronische Schwierigkeiten mit der Konzentration und über Gedankenabwesenheit. Deswegen hatte er in seiner Familie den Spitznamen „Astronaut“ erhalten und war zu der tiefen Überzeugung
gekommen, daß seinen Schwierigkeiten ein organischer Mangel zugrundeliegt.
In der Behandlung wurde seine tiefe narzißtische Verletzbarkeit bald sichtbar. Jede Kränkung seines Selbstwertgefühls setzte ihn außer Gefecht. Er war unfähig, sich in der Arbeit oder in persönlichen Beziehungen nachhaltig zu bemühen. Statt dessen schwelgte
er in grandiosen Tagträumen und Phantasien, in denen er seine höchst erfolgreichen Eltern und andere Familienmitglieder übertraf.
Als attraktiver und umgänglicher junger Mann litt Herr A. keinen Mangel an oberflächlichen Freundschaften mit Männern oder Frauen. Sein Problem war die Intimität. Er ging eine neue Beziehung mit einer jungen Frau ein, war ihr gegenüber aber von Anfang
an extrem ambivalent. Wenn er bei ihr war, dachte und träumte er von anderen Frauen, Prostituierte eingeschlossen, und hatte in der Phantasie Wünsche, die machtvolle, kaum zurückgehaltene zwanghafte, fetischistische und sadomasochistische Züge trugen. In
ihrer sexuellen Beziehung hatte er vorzeitigen Samenerguß und war ganz allgemein impotent. Wenn er allein war, masturbierte er häufig und zwanghaft. Immer wenn sie sich trennten, oft auf seine eigene Anregung hin, fühlte er sich vernichtet und depressiv bis hin
zu Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit und drängenden Suizidimpulsen. Wenn sie ihre Beziehung jedoch wieder aufnahmen, war seine Ambivalenz sofort wieder da. Er litt dann wieder daran, bei ihr zu sein, und lenkte seine Ablehnung und seinen Haß auf ihre kleineren physischen Mängel.
An einer Stelle deutete ich Herrn A., er könne weder mit seiner Freundin sein, noch ertragen, von ihr getrennt zu sein, doch müsse er sich von ihr trennen, um mit ihr sein zu können, und müsse mit ihr sein, um sich von ihr getrennt fühlen zu können. Seine Antwort war, dies sei ihm ein Rätsel. Wie das Rätsel der Sphinx enthielt es eine wichtige Wahrheit, die er aufzudecken hatte. Folglich wurde auf diese Deutung oft als auf den „berühmten Satz“ zurückgegriffen.
Die Arbeit an dieser Thematik nahm viel Zeit in Anspruch, in der immer deutlicher wurde, daß seine Freundin für ihn keine reale Person war. Er erlebte sie nicht als getrenntes, unabhängiges menschliches Wesen, sondern als mit ihm verschmolzen und ihn spiegelnd. Auf der einen Seite war sie ausschließlich ein Objekt, das ein gewisses Licht auf ihn warf, so daß ihre Schönheitsfehler unvorteilhaft auf ihn fielen, während ihre positiven Eigenschaften ihn in ein gutes Licht setzten. Auf der anderen Seite hatte er ein
überwältigend mächtiges Gefühl, daß er nicht einen Augenblick ohne sie leben könne. Der Gedanke, daß sie irgendwie fähig wäre, unabhängig von ihm leben und existieren zu können, machte ihn verrückt, war ihm unerträglich und führte zu quälenden
Verstimmungen.
Dieses Thema fand in seinen Ausdruck einer archaischen mütterlichen Übertragung. Sie zeigte sich in der Schwierigkeit, sich auf mich als einem unabhängigen Wesen zu beziehen, das fähig war, von ihm getrennt zu existieren. Auch ich war ein unpersönliches
Objekt, vorhanden, um von ihm gebraucht zu werden. Wenn er es sich andererseits gestattete, Nähe zu fühlen und mich mehr als Mensch und real zu erleben, so wurde dies sofort mit paranoid getönten Verdächtigungen verknüpft. Sie galten meinen Motiven und seiner Verwundbarkeit, von mir schmerzhaft verletzt zu werden. Es war ihm nahezu unmöglich, Verantwortung und Urheberschaft für seine Taten oder seine Gedanken zu übernehmen. Er zog es vor, mich als eine Autorität zu sehen, die er entweder versöhnlich stimmen konnte oder mit der er anderweitig klarkommen mußte. Er leugnete jedes Gefühl von Freiheit und Wahlmöglichkeit, was ihn sofort mit der schmerzhaften Erfahrung seines Nicht-Seins konfrontierte – nicht ganz lebendig und nicht wirklich eingebunden zu sein. In diese Phase fiel auch eine ausgesprochen perverse und fetischistische Periode. Er suchte Prostituierte in verschiedenen Verkleidungen und Identitäten auf, zog sie sexuellen Beziehungen mit Freundinnen vor, in denen er in den intimsten sexuellen Momenten dem sehr ängstigenden Gefühl ausgesetzt war, nicht wirklich lebendig und miteinander verbunden zu sein. Natürlich war auch ich für ihn solch eine Prostituierte, die ihn mit meinen Diensten gegen Geld versorgte und seinen Wünschen nachkam.
Obwohl Herr A. oberflächlich sich viel mehr auf mich und die Behandlung einließ und engagierter war als Frau H., war die zugrundeliegende Qualität ähnlich. Er fühlte sich tot, nicht lebendig, nicht fähig, sich vereint oder mit mir oder in seiner Behandlung seiend zu fühlen. Die Analyse war nicht seine, sondern etwas Äußerliches und von seinem Erleben Getrenntes, mit dem er nichtsdestotrotz für lange Zeit in einer zwanghaften,
instrumentalisierten Beziehung im Tun verbunden blieb.
Diskussion
Eine bemerkenswerte Charakteristik von Frau H. und Herrn A. ist ihre Unfähigkeit, weder mit dem Objekt noch ohne es sein zu können. Dies schien mehr als jeder andere einzelne neurotische Konflikt die Wurzel ihres Leidens zu sein. Auch mehrere Jahre Analyse lieferten keinen Beweis über eine zugrundeliegende schizoid destruktive Phantasie.
Deshalb sehe ich in diesen Fällen das Leiden in der Schwierigkeit, Beziehungen zu erleben. Diese Schwierigkeit berührt fundamental den Sinn für die Vermittlung einer Beziehung. Aus meiner Sicht stammt das Dilemma daher, daß eine der beiden Erlebnismodalitäten oder beider Integration beschädigt worden ist. In diesem Sinne sind Frau H. und Herr A. Beispiele für das Beziehungsdilemma, das, wie ich meine, als Dilemma ebenso in der psychoanalytischen Theorie besteht, das aber klar erkannt werden kann, wenn wir die Einsamkeit als unseren Ausgangspunkt und die Erlebnismodalitäten von Sein und Tun als unser Erklärungswerkzeug nehmen.
Ich bin mir dessen bewußt, daß diese Aussage an dem Fehlen eines Schlüsselmerkmals psychoanalytischen Denkens leidet. Es fehlt der Hinweis auf eine spezifische Ätiologie, die in einer bestimmten Entwicklungsphase verankert ist. Es mag ferner entgegnet werden, daß nur eine solche Ätiologie eine psychoanalytische Behandlung in diesen Fällen ermöglicht. Ich glaube, daß dieses Denken falsch ist und genau für diese Fälle wirklich gefährlich. Solch ein Argument steht selbst beispielhaft für die Orientierung auf das Tun, in dem ausschließlich spezifisch kausale Verbindungen und analytische Werkzeuge des Sekundärprozesses, die gewöhnlich durch Deutungen ihre Anwendung finden, heilend sind. Einer problematischen und beschädigten Beziehung im Sein kann nur mit
Behandlungsstrategien geholfen werden, die der Modalität adäquat sind, d.h. mit Behandlungsstrategien vom Sein-Typ, für welche die psychoanalytische Situation ein vorzügliches Medium und Vehikel darstellt (Erlich, 1991). Neben den spezifisch kausalen Weisen der Intervention (z.B. die Deutung) durch Schaffung, Aufrechterhaltung und Bereitstellung der psychoanalytischen Situation und der Erlaubnis, daß diese durch das analytische Paar dekonstruiert und wiedererschaffen wird, bringt der Analytiker kurative Einflüsse vom besonderen Sein-Typ mit ein, die weit über das hinausreichen, was er sagt oder zu tun intendiert (Erlich, 1995). Des weiteren können kausale Deutungen vom TunTyp, wenn sie nicht angebracht sind, dazu dienen, die Einsamkeit des Patienten zu verstärken.
Erlebnisdimensionen, Identität und Intimität
Ich habe zu zeigen versucht, daß Einsamkeit am besten verstanden werden kann, wenn besser verstanden wird, wie Beziehung und Zusammensein erlebt werden. Beziehung, Nähe und Zusammensein sind eng mit Intimität verwoben. Das Erreichen der Intimität
charakterisiert den Abschluß der Adoleszenz und den Weg in die Herausforderungen des beginnenden Erwachsenseins. Die Adoleszenz verlangt in der Tat zum ersten Mal in der Entwicklung die erfolgreiche Mischung und Integration der Modalitäten von Sein und Tun (Erlich, 1990, 1993). Die vollständige Antwort auf die Frage: „Wer bin ich?“ setzt mehr voraus als die Modalität des Tuns, die sicher erworbene Trennung von Selbst und Objekt, von Trieb und Konflikt und die Feinheiten intellektueller Differenzierung. Ebensowenig aber kann sie von der Modalität des Seins allein kommen – von Verschmelzung und Einheit mit dem Objekt und der Verläßlichkeit, Sicherheit und dem Wesen, die eine solche Einheit bietet. Natürlich müssen beide Modalitäten zur Verfügung stehen und einen Beitrag leisten und ausreichend gut miteinander integriert sein, um eine angemessene Antwort auf die Schwierigkeiten, die durch die Identitätsbildung gestellt werden, zu geben.
Ähnlich wird eine Lösung des Problems der Intimität, die ausschließlich in der Modalität des Tuns begründet ist, höchstens ein Bild von der Vorherrschaft der Triebe geben und nie über die erotische Frage, wer was wem tut, hinauskommen. Andererseits wird Intimität, deren Lösung ausschließlich in der Modalität des Seins liegt, nur so erlebt werden, wie es in tiefen spirituellen Vereinigungen, z.B. intensiv religiös oder mystisch, vorkommt.
Reines Sein, ohne das, was Tun dazugibt, kann keine Hilfe in der Begegnung zwischen den Geschlechtern anbieten, deren geistige, spirituelle, physische und sexuelle Vereinigung zu gegenseitiger Befruchtung, Nachkommenschaft und Familiengründung führt.
Scheitern der Intimität und Einsamkeit des Erwachsenen
Eine unvollständige Lösung der Entwicklungsaufgabe der Intimität bereitet den Weg zur Einsamkeit des Erwachsenen. Einsamkeit wird in dem Maße seelische Realität, in dem Intimität nicht erreicht wurde. Wahrscheinlich sind es verschiedene frühe
Entwicklungseinflüsse, die bestimmen, welche der zwei Arten der Einsamkeit vorherrschen wird. Wenn der Modus des Tuns vorherrscht, wird Einsamkeit am Verlust des intimen Objekts erlebt, an dem aktuellen Verlust oder an bewußten oder unbewußten
Phantasien über sein Verschwinden oder an dem Verlust seiner Liebe. Das klinische Bild wird entweder das einer Depression oder einer angemessenen Trauer sein. Wenn andererseits das Scheitern hauptsächlich von den Schwierigkeiten im Modus des Seins stammt, besteht in der Beziehung mit dem intimen Objekt eine Leere oder ein Mangel an Wirklichkeit und Substanz und eine fortwährend zu spürende Angst vor dem Nicht-Sein des Objekts. Sie mag sich bewußt als Angst vor plötzlichem Weggehen und Verschwinden
zeigen. Oberflächlich kann dies durchaus als ödipale Angst erscheinen, was sie in Wirklichkeit aber nicht ist. In diesem Fall rührt Angst von dem Erleben der Abwesenheit einer Beziehung, die beides, Objekt und Selbst, umfaßt. Die Angst beinhaltet zutiefst, daß
das Selbst nicht ist – daß es nicht sein und existieren kann, wie ja auch das Objekt nicht als seiend erlebt wird.
Die an diesem Problem leiden, klammern sich aktuell an das Objekt; denn sie fühlen, daß sie sonst keine Chance haben zu leben und zu existieren. Zur selben Zeit aber werden sie alles dafür tun, das Objekt nicht in einer miteinander geteilten Intimität zu erleben. Die vorrangige Angst besteht genau darin, mit dem Objekt intim allein zu sein;denn dann taucht das Erlebnis der inneren Leere auf und die extreme Schwierigkeit in der Beziehung kommt an die Oberfläche. In abwehrender Vorwegnahme werden viele
Strategien angewendet, deren Ziel darin besteht, den unerträglichen Zustand des Alleinseins in Gegenwart des anderen zu vermeiden. Eine viel verwendete Taktik besteht
darin, wie in den Phantasien über Untreue und Eifersucht oder wie in dem Eingehen von Nebenbeziehungen Dreiecke zu schaffen, nicht aus ödipalen Motiven, sondern zur Bevölkerung der inneren Szene, um nie mit dem intimen Objekt allein sein zu müssen. Ein solches Bild kann für die therapeutische Arbeit und das Verstehen extrem verwirrend sein.
Frau H.’s zwanghafte Beschäftigung mit der „anderen Frau“ könnte leicht ödipal eingeschätzt werden. Jedoch ist ihre eindrucksvolle Antwort auf meine Deutung, daß sie die andere Frau vielleicht in der intimen Beziehung mit ihrem Freund brauche, keine
hysterische Reaktion auf die Aufhebung der Verdrängung. Ihr Schmerz, wie er sich in ihrem plötzlichen affektiven Ausbruch zeigt, stammt aus der schneidenden Erkenntnis ihrer Schwierigkeiten rund um die Intimität und ihrer schrecklichen Angst in der Gegenwart eines anderen, sei es Freund oder Analytiker, allein zu sein. In gleicher Weise konnte Herr A. nicht mit seiner Freundin zusammen sein, ohne von Phantasien über andere Frauen überflutet zu werden. Sein Mangel an Gefühl für sie in ihrer Gegenwart paßt zu seinem Maturbationsverhalten in ihrer Abwesenheit. Sobald er auf ihre Getrenntheit stößt, ist er besessen von seinem Angewiesensein auf sie und von der Wut auf ihre unerwünscht eigenständige Existenz.
Das klinische Material unterstreicht die Aussage, daß Einsamkeit von den Schwierigkeiten, Störungen und Brüchen im Aufbau und in der Bewahrung der Intimität herrührt. In beiden Fällen entschied sich die Entstehung der Einsamkeit an dem Punkt, wo die Entwicklung des Adoleszenten ins junge Erwachsenenalter übergeht. Die spezifische
Störung scheint ihren Grund in schweren frühen Störungen zu haben, die Ausdruck im kompensatorischen Rückgriff auf das Tun finden, was zu einem aufgeblähten falschen Selbst auf Kosten der Erlebnisse eines wahren Selbst führt. Dennoch sind Frau H. und Herr A. sozial nicht isoliert. Beide suchen und wünschen Beziehungen und Liebesbeziehungen. Sie fühlen sich jedoch durch die Anforderungen der Intimität an ihre beschädigte und schwach integrierte Fähigkeit zu Beziehungen im Sein und Tun extrem beunruhigt und verwirrt. Ihre beschädigten Beziehungen im Tun spiegeln sich im Sexuellen und in ihren Schwierigkeiten in anderen Lebensbereichen wider. Die Einsamkeit in der Sphäre des Seins ist jedoch die schwierigste: das Objekt hat für sie keine wirklich getrennte Existenz. Es gibt einen ungeheuer starken Wunsch, mit dem Objekt zu verschmelzen, aber
gleichzeitig ist die Fähigkeit dazu schwer beeinträchtigt und mangelhaft. Das deutet darauf hin, daß die zentrale Schwierigkeit aus dem nicht integrierten Zustand von Sein und Tun stammt, die in zwei gleichzeitig nebeneinander bestehenden Weisen erfahren werden.
Erstens trägt ihr Objekterleben, existent und in der Welt zu sein, einen Zug von Unwirklichkeit. Zweitens fehlt entsprechend ein wirkliches, subjektives Erleben des eigenen Selbst, als ob sie mit der Ausnahme spezifischer, heftiger, starker Gefühle wie Schmerz und Demütigung nicht ganz lebendig und nicht ganz in der Welt seien. Als Folge können sie weder mit dem Objekt noch ohne es sein. Sie können sich nicht erlauben, mit einem Objekt zu verschmelzen, das auch von ihnen getrennt ist und unabhängig existiert. Aber sie können sich auch nicht zugestehen, Sehnsucht nach dem Objekt und Trauer über Abgetrenntheit und Verlust zu erleben. Das kulminiert im Zustand der Einsamkeit in Anwesenheit des Objekts und in der Unfähigkeit, dauerhafte Intimität zu entwickeln.

