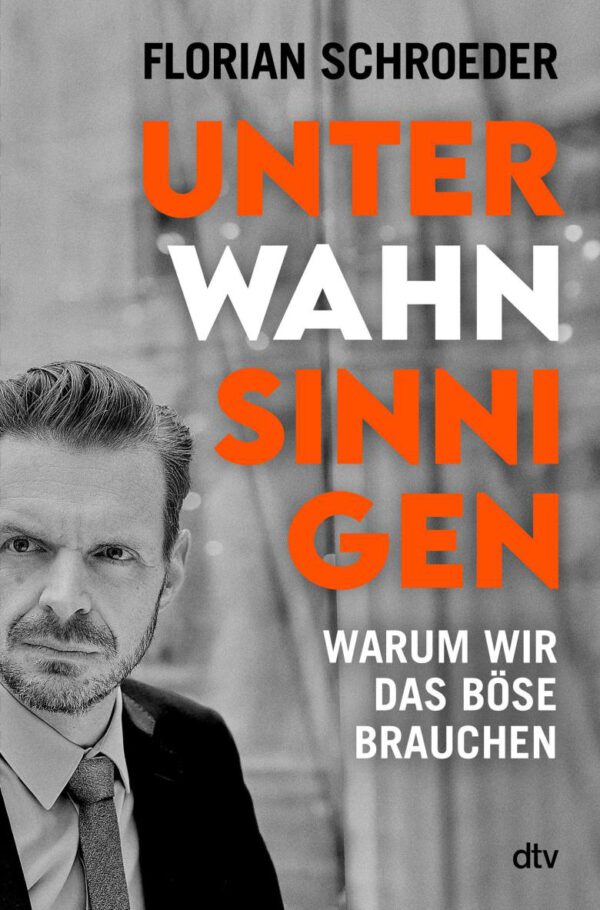Männer sind toxisch, sexsüchtig, kommunikationsunfähig, gewaltsam. Das scheint der neue Konsens zu sein: Sie sind das Böse in Menschengestalt. Warum es dringend nötig ist, genauer hinzuschauen. Und wieso deutsche Männer dreimal Pech hatten.
Wenn sich unsere Zeit auf etwas einigen kann, dann auf die Diagnose, dass der Mann das böse Geschlecht ist. Vieles spricht ja auch dafür: Im Maßregelvollzug genau wie im Gefängnis stellen Männer die überbordende Mehrheit der Gefangenen. Der Mann zettelt Kriege an und neigt häufiger zu Gewalt oder generell grenzüberschreitendem Verhalten. Kraft, Stärke und Macht, Expansionen, Eroberungen und Schlachten sind historisch seine Insignien, Sieg und Niederlage sein Koordinatensystem. Wie sehr Macht und Gewalt auch die Beziehung zu Frauen prägt, ist spätestens seit #MeToo deutlich geworden. Männliche Energie ist zerstörerische Energie.
Männliche Identität ist gefährliche Identität: Dreimal so viele Männer wie Frauen bringen sich um, in der Pubertät sind es sechsmal so viele Jungen wie Mädchen. Männer sterben dreimal häufiger als Frauen bei Verkehrsunfällen, trinken und rauchen mehr, sind bedeutend häufiger obdachlos. Gleichzeitig sind die Stärken von gestern zu den Schwächen von heute geworden. Klassische Männerdomänen sind in sich zusammengefallen – zwei Drittel der traditionellen Männerberufe, insbesondere jene, die körperliche Kraft erfordern, sind weg. Es dominiert die Dienstleistungsgesellschaft, die mit vermeintlich weiblichen – guten – Attributen belegt ist: Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität. Die allgemeine Wahrnehmung lautet: Der Triumphzug des sanften Guten – des vermeintlich Weiblichen – ist in vollem Gange; der Untergang des Toxisch-Bösen – des vermeintlich Männlichen – ebenfalls.
Das führt unter Männern zur Verunsicherung: Im Internet bestärken sich Männer darin, Opfer von Frauen zu sein, genauer, Opfer des Feminismus. Die Speerspitze bilden die „Incels“, also unfreiwillig ohne Frauen und Sex lebende Männer. Deren Wut, ungestört in ihrer gegenseitigen Selbstbestätigung, kann umschlagen in Hass, wie 2021 im südenglischen Plymouth, als ein 22-jähriger Incel fünf Menschen tötete, darunter seine Mutter. Auch der misogyne und reaktionäre, aber mit 13 Milliarden Klicks sehr erfolgreiche TikToker Andrew Tate, der im Internet den Jungs erklärt, wie sie Alphamänner werden, ist ein Ausdruck dieser Gegenreaktion.
Es gibt Feministinnen, die fordern, die destruktive Kraft des Mannes müsse nun genauso zerstört werden, wie sie jahrhundertelang Frauen zerstört hat. Doch dieses Denken bleibt dem, wogegen es aufbegehrt, verschwistert. Denn es geht von einem unauflösbaren Gegensatz aus, bei dem das Pendel nur in die eine oder die andere Richtung ausschlagen kann – nun eben in Richtung Frau. Es bleibt dem „Wie du mir, so ich dir“-Prinzip verbunden. Die Geschlechterforschung liefert einen spannenden und produktiven Beitrag zu dieser Debatte. Doch bisweilen wirken Teile der Gender Studies wie gegenwärtige Abziehbilder von Nietzsches Macht des Ressentiments, in dem man sich der eigenen Schwäche versichert und die Schuld für diese Position der Gegenseite anlastet. In diesem Zusammenhang brauchen sich die Geschlechter, um sich gegenseitig die Schuld zu geben, um die jeweils andere Seite als das Böse zu brandmarken. Sie brauchen das Böse, um sich selbst zu definieren. Sie finden Identität, indem sie das andere Geschlecht als übermächtiges anklagen und entwerten.
Die destruktive Schleife beginnt immer wieder von Neuem. Das gilt übrigens für beide Seiten: Im Sommer 2023 moderierte ich beim Philosophiefestival phil.cologne einen Abend mit dem Medientheoretiker Norbert Bolz. Laut Bolz falle dem Mann heute die Aufgabe des Sündenbocks zu, er habe die Situation, wie sie gerade sei, zu ertragen, ohne sich zu beschweren. Zugleich spricht er von den „woken Taliban“ und einem Kulturkrieg gegen die Männlichkeit. Damit ist Bolz Beschwerdeführer in genau dem Sinne, wie das echte Männer seiner These nach niemals sein sollten. Er huldigt einem erzkonservativen unterkomplexen Verständnis von Männlichkeit und einer beleidigten fortschrittsverweigernden Haltung, indem „männliche Männer“ und „weibliche Frauen“ die Verlierer sind, während weibliche Männer und männliche Frauen irgendwie als Sieger vom Platz gehen. Schuld am eigenen Hadern mit der Gegenwart sind auch hier die anderen.
Um weiterzukommen – gemeinsam, nicht gegeneinander –, müssen wir aus einer Machtlogik heraustreten, nach der es immer nur Täter und Opfer geben kann. Stattdessen möchte ich vorschlagen, den Versuch zu unternehmen, die Geschlechterbeziehung ohne Macht- und Herrschaftsverhältnisse zu denken. Das bedeutet in der Konsequenz, Frauen nicht länger a priori als Opfer und Männer als Täter wahrzunehmen, sondern diese Begriffe über Bord zu werfen und sie als Stützräder einer Dialektik aus der Vergangenheit zu sehen. Das bedeutet nicht, bestehende Machtverhältnisse und die ungerechten, ausbeuterischen Strukturen zu leugnen, es bedeutet, eine andere Perspektive gleichberechtigt danebenzustellen.
Der Mann: nur ein Krieger?
Dazu gehört auch, dass wir eine traditionelle, geradezu biologistische Rollenverteilung aufbrechen, die den Mann als wild und zerstörerisch und die Frau als friedlich und zivilisiert sieht. Es ist ein Geschlechterbild, das Johann Gottlieb Fichte zu Beginn des 19. Jahrhunderts beschrieben hat – und das bis heute fortwirkt. Schon in der Kindheit sei der Knabe „wild, zerstörerisch, egoistisch und selbstsüchtig“, schreibt Fichte. Darum will er später als Mann herrschen und befehlen, denn er ist der perfekte Krieger. Für seinen Kampfeswillen, seine Selbstständigkeit und Unabhängigkeit wird er bewundert. Ethisch ist diese Position für Fichte aber wertlos, sie ist sogar Grund allen Übels, da sie „als blinder Trieb wirkend einen sehr unmoralischen Charakter hervorbringt“. Erschwerend kommt hinzu, dass in ihm „ursprünglich nicht Liebe, sondern Geschlechtstrieb“ ist. Er ist zwar als Kämpfer geeignet, aber aufgrund seiner Herrsch- und Sexsucht ethisch unbrauchbar.
Die nötige Portion Sittlichkeit, die er braucht, lehrt ihn einzig die Frau durch ihre Liebe in der Ehe. Will er also mehr sein als ein Gefangener seiner rohen Triebe, muss er sich dieser ordnenden Energie unterwerfen. Die Lektion des Guten lernt der Mann nur hier, beim angeblich so emotionalen, denkunfähigen Weibe. „Die Frau sprengt gleichsam durch den Zwang ihrer Güte das egoistische Bollwerk des Mannes und lenkt ihn um auf das Akzeptieren von etwas anderem außerhalb seiner selbst“, wie es der Soziologe Christoph Kucklick beschreibt.
Sind Männer ohne Innenbezug?
Die Frau nimmt sich also eines unmoralischen Monsters an, das sie mit der Kraft ihrer Liebe erst zum Menschen macht. Die Frau ist für Fichte Geburtshelferin des ganzen, des ethischen Mannes. Die Tiefausläufer dieses Denkens zeigen sich bis heute in Gesetzen wie dem Ehegattensplitting. Sein Funktionieren setzt ein Zerrbild von Mann und Frau voraus, wonach er für die materielle Sicherheit draußen sorgt und sie für die häusliche Geborgenheit drin. Kucklick bringt es auf die Formel: „Der Mann bessert sich – für die Frau.“ In ihrem Blick erst kann er sich erkennen, der werden, der zu sein von ihm erwartet wird. Das bildet den Ausgangspunkt für eine unheilvolle Dynamik, die bis heute wirkt und männliche Identität bestimmt: Je stärker eine Gesellschaft dazu tendiert, weibliche Eigenschaften als gute zu sehen und männliche als tendenziell böse, desto stärker fühlt sich der Mann motiviert, sich zu dem zu machen, der er sein sollte, wenn er ein guter, ein richtiger Mann sein soll – entweder für die Frau oder eben gegen sie. Der zweite Weg endet meist in toxischer Männlichkeit.
Der Psychologe Markus Theunert schreibt über seine Erfahrungen als Männertherapeut: „Uns Männern sitzt die Angst in den Knochen, in unserem Innersten lauere das Böse. Diese Angst verhindert den vertrauensvollen Innenbezug und fördert die Selbstentfremdung, bis die seelische Verwahrlosung eingetreten ist, die aus der Angst vor dem Bösen eine sich selbst erfüllende Prophezeiung macht.“ Damit wäre eine unheilvolle Dialektik an ihr Ende gekommen: In die Welt geworfen als rohes Böses, stets bestrebt, besser zu werden, landet der Mann am Ende doch beim vollendeten Bösen, dem zu entkommen doch gerade sein Lebensziel war. Aus Theunerts Sicht prägt diese Dynamik noch immer viele Beziehungen.
Oft seien es die Frauen, die ihre Männer verbessern, zurechtweisen, kontrollieren und den Eindruck erwecken, als sei es ihre Aufgabe, hier gerade noch das Schlimmste zu verhindern: eine Trottelei, eine Unverschämtheit oder irgendeinen anderen unkontrollierten Affekt. Männer reagieren auf diese weibliche Erziehungsanstalt meist mit analoger passiv-aggressiver Abwehr. Diese Bänder des Zerstörerischen sind erstaunlich stark, weil sie die uralten Rollen auf so toxische Weise bestätigen und erhalten. Die Frau kann ihren überlegenen Blick behalten, dessen Botschaft ist: „Ich sehe was, was du auch sehen könntest, wenn du es nur wolltest.“ Der Mann ist durch ihre besserwisserische kontrollierende Zuwendung beschützt davor, dem unkontrollierten, gefürchteten Bösen in sich zu verfallen.
Warum fällt es dem Mann, diesem doch nach wie vor unbestritten mächtigen und machtvollen Geschlecht, so schwer, hier seine eigene Rolle zu finden. Meine These ist: Er hat es nie gelernt und das hat viel mit abwesenden oder auch sprachlosen Vätern zu tun. Ich habe immer wieder wahrgenommen, dass viele Männer meiner Generation Söhne des Schweigens sind, Kinder der Sprachlosigkeit. Söhne von Vätern, die sich nicht ausdrücken konnten. Männer, die zu sehr vielen Innenwelten offenbar keinen Zugang hatten. Sie haben nicht gelogen, nicht getäuscht, sie haben nur enttäuscht, weil sie sich selbst fremd geblieben waren.
Auf der Suche nach Adoptivvätern
Das hat sie zu sprachlosen Eingekerkerten gemacht, die aber in dieser Begrenzung ziemlich oft sehr zufrieden schienen. Wenn es darauf ankam, waren sie weit weg, unerreichbar. Ich kenne Söhne, die diese Unerreichbarkeit immer wieder gesucht haben, ein Leben lang, ihr hinterhergelaufen sind wie einer Fata Morgana – und immer wieder enttäuscht von diesen Reisen zurückkehrten und umso verzweifelter bei sich selbst ankamen.
Ich habe über viele Jahre vergeblich nach Vorbildern für Männlichkeit gesucht. Da mein eigener Vater abwesend war, adoptierte ich meine Väter – eine Formulierung, die ich Peter Sloterdijk verdanke. Ich suchte mir Väter, Vatergestalten, aber auf Zeit, so, wie ich sie brauchte und wie sie mir Lehrer, Vorbilder, Idole sein konnten. Ich sammelte nach und nach Bruch- und Versatzstücke dessen auf, was ich nur als Scherben kannte. Begierig atmete ich ein, wenn sie in sich zu vereinen schienen, was ich für erstrebenswert hielt, aber innerlich fehlte. Ich inhalierte Gesten, Haltungen, Sprechweisen und Bewegungen, imitierte alles, was mir den nächsten Schritt in diesem unübersichtlichen Feld ermöglichen sollte.
In dieser einsamen, aber ergiebigen Suche hielt ich mich lange für einen singulären Außenseiter, für einen Bedürftigen, für einen ewigen Nachhilfeschüler in Sachen männlicher Identität. Ich musste aufholen, was anderen in die Wiege gelegt worden war, ich mir angesichts eines Vaters, zu dem ich keinen Kontakt mehr hatte, aber erst erarbeiten musste.
Ich wollte mich selbst mit Höchstgeschwindigkeit einholen und hatte doch immer das Gefühl, zu spät dran zu sein. Ich musste Fragen finden zu Antworten, die anderen wie selbstverständlich gegeben worden waren. Es dauerte lange festzustellen, dass meine Suche vielleicht eine sein könnte, die sehr viele andere mit mir teilten. Erst viel später verstand ich, dass auch anwesende Väter abwesend sein können – und dass abwesende anwesend sein können, wenn auch nur als Negativfolie, indem man sich von ihnen gewaltsam zu befreien sucht und ihnen in dieser Absetzbewegung erst recht verbunden bleibt.
Woher kommt das Starre, das Unbewegliche? Der Psychiater Matthias Franz spricht von drei verheerenden Generationen deutscher Väter: Erst gab es den wilhelminischen – streng, hart, nationalistisch. Dann kam der nationalsozialistisch-soldatische, der beschädigt oder emotional verstümmelt zurückkam, und heute erleben viele den abwesenden Scheidungsvater. Die damit einhergehende Verpanzerung und Sprachlosigkeit vererbt sich von Generation zu Generation. Die eigene Schuld, das Scheitern, die bösen Anteile, werden den folgenden Generationen unausgesprochen eingepflanzt, als blinder Passagier mit auf die Reise gegeben, statt in den Raum gestellt und angeschaut zu werden. Eine Veränderung dieser traditionellen Rollen betrifft beide Geschlechter: „Wenn der Mann aus seiner traditionellen Rolle aussteigt und schwächelt und gefühlig wird, […] dann bekommen viele Frauen große Ängste. […] Insbesondere intellektuelle Frauen sind vom schwachen Mann völlig irritiert“, sagt Matthias Franz.
Neue Rollenbilder
Das Widerspruchsvolle dieser Anforderungen lässt viele Männer hadern und straucheln. Jenseits aller unzureichenden Gut-Böse-Geschlechterstereotype konnten Psychologen immer wieder zeigen, dass es eine genuin männliche oder auch väterliche Rolle geben kann, die weder besser noch schlechter als die der Mutter ist – sie tritt hinzu, als produktive Unterbrechung der natürlichen Mutter-Kind-Dyade. Zur Funktion des Vaters gehört es demnach, dem Kind verstärkt eine Kontrolle über den eigenen Körper beizubringen, das Geschlecht des Kindes stärker zu betonen und die Autonomie des Kindes zu fördern.
Besonders ist er zuständig dafür, dass das Kind lernt, Regeln einzuhalten. Zugespitzt formuliert: Wenn es Aufgabe der Mutter ist, Leben zu schenken, für das Leben zu öffnen, so könnte es die Aufgabe des Vaters sein, das Sterben zu lehren. Das ist weniger dramatisch, als es klingt. Der Gedanke knüpft an einen sehr heiteren Essay von Michel de Montaigne an, der „Philosophieren heißt sterben lernen“ überschrieben ist. Dort heißt es: „Das Leben an sich ist weder Gut noch Übel, sondern nur der Ort, wo Gut und Übel so viel Platz einnehmen, wie ihr ihnen zugesteht.“
Sterben lernen heißt dann vielleicht nur, neben dem Möglichkeitsraum auch die Begrenzung dieses Raums anzuzeigen, neben den Anfang auch das Ende zu stellen, neben das Gelingen auch das Scheitern, das weder gut noch böse, noch nicht einmal schlecht sein muss. Diese oft als negativ oder dunkel bezeichnete Seite des Menschen einzubeziehen, sie weder zu dämonisieren noch zu harmonisieren, könnte – auch – eine wesentliche Aufgabe des Vaters sein.
Wir leben in einer Übergangsphase, die viele verunsichert. Das Paradox besteht darin, dass die alten Verhaltenslehren nicht mehr taugen. In einer Welt, in der wir weder das Weibliche noch das Männliche als Gutes oder Böses emporheben oder erniedrigen müssen, könnten sich am Horizont neue Selbstverständnisse auftun. Bei denen es nicht mehr darum geht, dass Männer „männlich“ oder Frauen „weiblich“ sein müssen, sondern sich alle Geschlechter – binär oder nonbinär – aller und keiner Verhaltensweisen bedienen können, ohne einer Schublade für ihre Entscheidung zu bedürfen.
Florian Schroeder, geboren 1979, ist Kabarettist und Autor. Der voranstehende Text ist ein Auszug aus seinem neuen Buch „Unter Wahnsinnigen. Warum wir das Böse brauchen“ (dtv, 288 Seiten, 24 Euro. Erscheint am 12. Oktober 2023).