Ulme / Elm – Sylvia Plath
(1) Ich kenne den Grund, sagt sie. Ich kenne ihn durch meine große Pfahlwurzel.
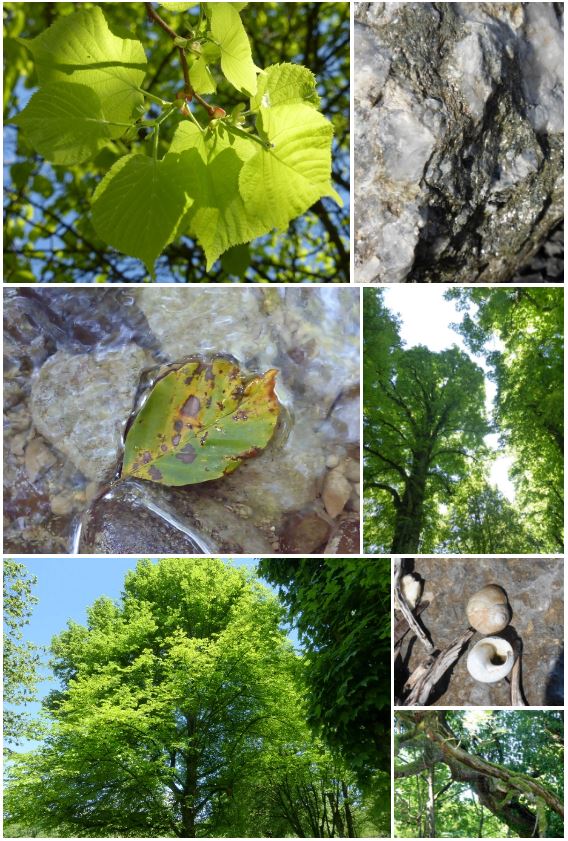
Das ist es was du fürchtest.
Ich fürchte es nicht: weil ich dort war.
(2) Hörst du das Meer in mir,
ist es unbefriedigend?
Oder die Stimme aus dem Nichts, die dein Wahnsinn ist?
(3) Liebe ist ein Schatten.
Wie du daliegst und ihr nachweinst.
Hör: das sind die Hufe: sie ist fort, wie ein Pferd.
(4) Ich werde die ganze Nacht so galoppieren, ungestüm,
bis dein Kopf ein Stein ist, dein Kissen ein Stück Torf,
widerhallend, widerhallend
(5) Oder soll ich dir den Klang der Gifte bringen?
Das jetzt ist Regen, die große Ruhe.
Und das die Frucht davor, zinnweiß wie Arsen.
(6) Ich habe jede Qual des Sonnenuntergangs ertragen.
Verdorrt bis zur Wurzel
brennen meine roten Fasern und stehen, wie eine Handvoll Draht.
(7) Ich breche in Stücke, die mich umfliegen wie Keulen.
Ein Wind von solcher Wucht
wird kein Herumstehen dulden: ich muss aufschreien.
(8) Auch der Mond ist gnadenlos, grausam ausgedörrt,
unfruchtbar,
Sein Glanz versengt mich. Oder ich habe ihn vielleicht gefangen
(9) Ich lass ihn gehen. Ich lass ihn gehen.
Vermindert, flach, wie nach radikaler Operation.
Wie deine bösen Träume mich beherrschen, mich ausstatten.
(10) Ich bin bewohnt von einem Schrei.
Nachts flattert er aus
und sucht mit seinen Haken nach etwas zum Lieben.
(11) Mich schreckt dieses dunkle Ding,
das in mir schläft; tagsüber fühl ich sein weiches, federleichtes Drehen, die Bösartigkeit.
(12) Wolken ziehen, zerstieben.
Sind das die Gesichter der Liebe, diese bleichen Unwiederbringlichkeiten? Schlägt dafür mein Herz?
(13) Ich bin unfähig für mehr Wissen.
Was ist das, was für ein Antlitz, so tödlich erstickend zwischen den Zweigen?
(14) Es ist ein Schlangengiftkuss, lähmt den Willen. Das sind isolierte, schleichende Fehler
die töten, die töten, die töten.
Struktur
Das Gedicht besteht aus vierzehn Strophen mit jeweils drei nicht reimenden Zeilen; eine für Plath charakteristische Struktur. Dies ist, wie viele ihrer anderen Gedichte, ein Ego-Monolog in freien Versen, mit knappen Linien ungleicher Länge, die die Bedeutung und Emotionen des Dichters widerspiegeln.
Sprache und Bilder
Sylvia Plaths Gedichte sind normalerweise dicht und oft dunkel. Sie verwendet lebendige und einfallsreiche Bilder, die auf verschiedene Arten interpretiert werden können. Hier vermittelt sie Bedeutung durch komplexe, weitreichende und unterschiedliche Ideen, ähnlich wie blinkende Kameraaufnahmen – Ulme, Pferd, Gift, Träume usw. So zufällig sie auch erscheinen mögen, die Bilder überlappen sich und wiederholen sich geschickt, zum Beispiel die Die Gewalt des zerbrochenen Baumes in Strophe 7 wird durch das mörderische Gesicht in Strophe 13 wiedergegeben. das Pferd in Strophe 4 wird in Strophe 5 wiederholt; Der Vogel in Strophe 10 taucht in Strophe 11 wieder auf. Es gibt viele andere. Sie dienen dazu, das Gedicht so zusammenzustellen, dass Plath ein erschreckendes Bild von Depression, Verzweiflung und Wut zeichnet und tief in emotionale Tiefen gräbt.
In ihrem Gedicht „Elm“ fasst die amerikanische Dichterin Sylvia Plath ihre tiefste Sehnsucht nach einer liebenden Bezogenheit in verstörender Weise in Worte.
Sie drückt ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen in Bildern aus, die uns nicht unberührt lassen können, eben weil sie an ein ureigenes archaisches Bedürfnis rühren: Das basale Bedürfnis, sich liebend zu beziehen: „looking for something to love“, das durch seine Unerfülltheit zu etwas höchst Bedrohlichem wird. Sie spricht in „Elm“ aber auch über die Auswirkungen des Fehlens eines Aufgehobenseins in einer Beziehung, die die Entfaltung ihres wahren Selbst ermöglicht hätte. In erschreckenden Bildern beschreibt sie ihre innere Fragmentierung und vermittelt sie
gleichzeitig durch die Sprachmelodie und die Struktur ihres Gedichtes. Sylvia Plath konnte sich nicht in einer verlässlich-akzeptierend liebenden Beziehung wiederfinden. Da sie im tiefsten Innern wusste, dass sie ihr wahres Selbst nicht gelebt und
schließlich jede Hoffnung darauf aufgegeben hatte, nahm sie sich mit 30 Jahren das Leben; sie brachte sich um, indem sie ihren Kopf in den Backofen des aufgedrehten Gasherds legte.

Selbstbildnis 1952 Sylvia Plath
Die Beatles kamen und der Minirock, England trat der EWG bei und nahm das Dezimalsystem in Kauf, Gorbatschow stand auf und Rußland wurde frei, aber die tote Sylvia Plath ist noch immer so jung und dreißig wie an jenem eiskalten 11. Februarmorgen 1963, als sie im ersten blauen Licht die Tür für ihre Kinder abdichtete, ein sauber gefaltetes Handtuch unterlegte und den Kopf in den Gasherd steckte.
Heute wäre sie so alt wie John Updike und Philip Roth, könnte mehrfach geschieden und geliftet sein, überflüssige Romane schreiben über „ihre Erotik, die ziemlich stark war“. Lady Lazarus, aber schon 65, eine Überlebende ihrer eigenen Wahnvorstellungen: „Dying / Is an art, like everything else. / I do it exceptionally well.“ Dafür brauchte sie dann keinen mehr.
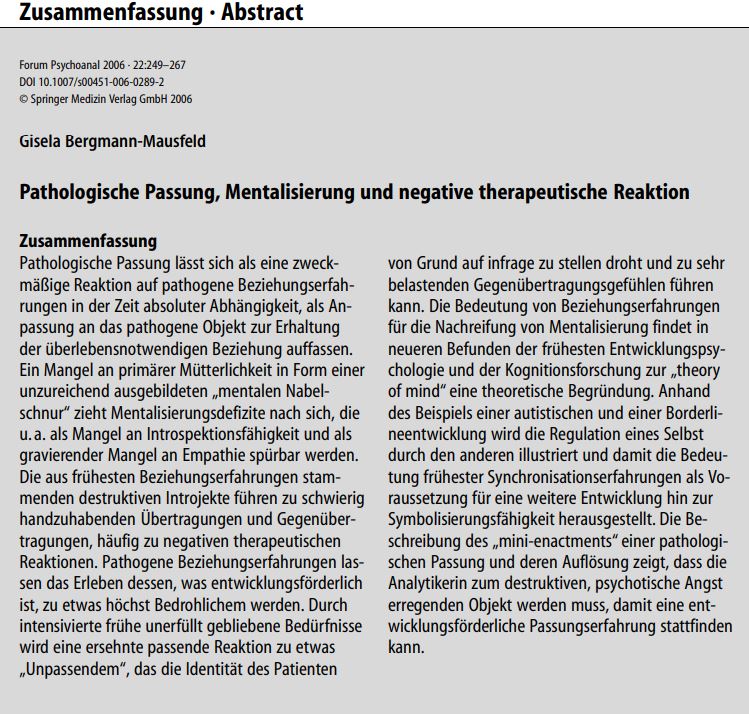
Komm doch heraus aus Deiner schizoiden Zitadelle!
Pathogene Beziehungserfahrungen und die schizoide Zitadelle
Ein Selbst, das lieben und geliebt werden will, sich aber aufgrund seiner Erfahrungen und deren psychischer Verarbeitung in seiner schizoiden Zitadelle so abgeschottet hat, dass es fast nicht mehr erreichbar erscheint, dieses Dilemma des schizoiden Menschen – der voller Sehnsucht nach Kontakt zu seinem wahren Selbst und zum anderen ist, ein Kontakt, den er zugleich zutiefst fürchtet –, wurde schon früh u.a. sehr ausführlich von Guntrip (1968) in seiner immanenten Logik erfasst und beschrieben. Guntrip, der die
tiefsten Ängste des Menschen als Ausdruck von Beziehungs- und damit Abhängigkeitsängsten verstand, betonte die Bedeutung des Analytikers als reale, hilfreiche Person. Eine schizoide Zitadelle, entstanden durch pathogene Beziehungserfahrungen, ist durch den Therapeuten nicht zu betreten und kann vom Patienten nur unter höchster Angst geöffnet oder verlassen werden. Das, was zur Wahrnehmung und damit Befreiung des eingeschlossenen Selbst führen könnte, nämlich ein affektives „attunement“ oder auch eine
Passung zwischen Analytikerin und Patient, ist nur mit dem Erleben größter Angst herzustellen.

Dying
Is an art, like everything else.
I do it exceptionally well.
I do it so it feels like hell.
I do it so it feels real.
Sterben
Ist eine Kunst, wie alles andere.
Ich mache es außergewöhnlich gut.
Ich mache es so, dass es sich wie die Hölle anfühlt.
Ich mache es so, dass es sich echt anfühlt.
Entwicklungspsychologischen Befunden zufolge entwickelt sich das Intersubjektivität und Mentalisierung ermöglichende System bereits während der Schwangerschaft (wie etwa entsprechende Studien
zur Wiedererkennung von Stimme oder Geruch der Mutter belegen) und beginnt mit der Geburt, zwischen Mutter und Baby eine abstrakte Verbindung aufzubauen, die ich als mentale Nabelschnur bezeichnen möchte. Diese Verbindung wird auf der Basis vorgegebener Prädispositionen etabliert, über die Gesichtsidentifikation, die Blick- und Aufmerksamkeitssynchronisation (s. z.B. Woodward 2005), Protokonversation (Trevarthen 1998) und früheste Imitation. Bereits diese Imitationsleistungen machen die Verfügbarkeit eines gemeinsamen Kommunikationskodes deutlich,
über den ein erster emotionaler Kontakt mit einem Gegenüber aufgebaut werden kann, und der bereits zum Teilen eines gemeinsamen Erlebnisraums führt. Dieser gemeinsame Erlebnisraum wird gefestigt und ausdifferenziert durch all das, was Stern
(1999) Vitalitätsaffekte nennt und die mit ihnen einhergehende Duett-Struktur der Protokonversation, in der Mutter und Kind
fest vorgegebene Erwartungen über eine optimale temporale und tonale Passung teilen (Trevarthen 1998; Trevarthen u. Malloch
2000). Hier wird bereits der Grundstein für das Entstehen des Übergangsraums gelegt. Die frühesten Beziehungserfahrungen
können also nur dann in einer ausreichend guten, d.h. in einer der Natur und den Erwartungen der beteiligten Systeme angemessenen Weise verlaufen, wenn sie ganz spezifische Passungserfahrungen darstellen. Erst eine solche Passung in den Interaktionen ermöglicht ein mental-affektives Andocken des sich entwickelnden ToMM
des Säuglings an das der Mutter und somit erst die Ausbildung entsprechender Mentalisierungsleistungen eines Ichs. Werden die
biologisch vorgegebenen Erwartungen der am Aufbau eines ToMM beteiligten Teilsysteme nicht erfüllt, werden also passende Beziehungserfahrungen in den kritischen, vulnerablen Entwicklungsphasen dieser Systeme nicht gemacht, so kann sich eine verbindende und ausreichend gute mentale Nabelschnur nicht entwickeln. Die dadurch verursachten strukturellen Defizite in der affektiv-emotionalen Organisation des Selbst müssen, soweit möglich, durch kompensatorische Heranziehung anderer Teilsysteme
ausgeglichen werden, u.a. in Form von vorzeitiger Ichreifung, Intellektualisierung etc. (Die Verarbeitung eines derartigen Defizits
mit strukturell-emotionalen Auswirkungen in Form einer schweren Depression mit Zwangsdenken beschreibt Bollas, 1995, in einer ausführlichen Falldarstellung.) Die Notwendigkeit einer Stabilisierung von Bindungssystemen lässt sich an den ethologischen Beispielen der Graugansprägungen von Lorenz und, noch beeindruckender,
der Harlowschen Affen illustrieren, die zeigen, dass eine kompensatorische Stabilisierung von Bindungssystemen, denen in der kritischen Entwicklungsphase die passende Beziehungserfahrung versagt geblieben ist, über Surrogate hergestellt wird.
Konsequenzen dieser theoretischen Konzeption für die Psychoanalyse
Von dem bisher Beschriebenen ist für die Psychoanalyse besonders die Tatsache von Bedeutung, dass die für die Mentalisierung verantwortlichen Systeme für ihre Ausdifferenzierung und Entfaltung auf ganz spezifische Inputs, Beziehungserfahrungen, angewiesen sind. Spätestens seit dem Entstehen der Zwei-Personen-Psychologie, vertreten durch u.a. Ferenczi, Fairbairn, Guntrip, Balint, Winnicott sowie ihre heutigen Nachfolger, ist die Bedeutung solcher Beziehungserfahrungen innerhalb eines analytischen Prozesses
formuliert worden.
Mit unserem heutigen Wissen über die früheste Entwicklung bedeutet dies, für die Behandlungstechnik von strukturellen
Störungen zur Festigung der mentalen Nabelschnur über ein affect attunement Korrelationen oder, besser gesagt, Passungen
bereitstellen zu müssen. Spezifische Beziehungserfahrungen müssen ermöglicht werden, um als Erwartungen derartiger
Beziehungserfahrungen, als representations of interaction that have been generalized (RIGs), internalisiert werden zu können. Dies bedeutet jedoch keineswegs, die „bessere Mutter“ sein zu müssen oder eine „korrigierende emotionale Erfahrung“ aktiv herbeizuführen. Es geht vielmehr um das Verstehen des inneren Zustands des
Patienten – und dies bedeutet ganz wesentlich, zulassen zu müssen, als Analytikerin zum destruktiven Objekt zu werden –, um
das Verstehen seiner Entwicklungsbedürfnisse sowie das Zulassen der Wiederaufnahme und Fortführung des vorzeitig unterbrochenen Entwicklungsweges. Weil das anfängliche Chaos des Erlebens mit
der Ausbildung von Erwartungen geordnet werden kann, weil auf diese Weise Angst bleibend reduziert werden kann, weil auf
der Grundlage einer Sicherheit in der Beziehung die Welt – und dann auch die innere Welt – exploriert werden kann, ist es von grundlegender Bedeutung, ordnende Erwartungen überhaupt erst entstehen zu lassen. Die Erfahrung der Erfüllung derartiger Erwartungen bildet also die Basis für die strukturbildende Arbeit.
Richtet sich die Aufmerksamkeit aber nicht auf das primäre in seiner Entwicklung gestörte Teilsystem, sondern auf ein höheres interpretatives „System“ – in dem zwar die Schädigung des relevanten Primärsystems ebenfalls seinen Ausdruck findet –, ist eine Nachreifung der geschädigten Strukturteile nicht möglich. Natürlich
können andere affektive und kognitive Teilsysteme kompensatorisch Störungen im ToMM, bezogen auf das psychische Gesamtgefüge, auffangen, doch können sie diese in der Regel nicht kausal beseitigen.
Daher muss das vorrangige Bemühen der „Reparatur“ der kausal verantwortlichen Struktur gelten, also direkt da einsetzen,
wo die genetische Störung liegt. Dabei ist davon auszugehen, dass es eine gewisse Plastizität und Möglichkeit der Nachreifung dieses Systems gibt, sofern ihm nachträglich der passende Input, im vorliegenden Fall passende Beziehungserfahrungen, d.h. das Verstehen der Entwicklungsbedürfnisse, zur Verfügung gestellt wird.
Die Erfahrungen der therapeutischen Praxis sprechen für eine solche Plastizität, auch wenn sich dort „direkte Reparaturen“ nur schwer von kompensatorischen Effekten trennen lassen.
Damit stellt sich die Frage, welche Inputs, also welche Beziehungserfahrungen, ein in seiner Entwicklung gestörtes ToMM
für eine Nachreifung benötigt. Es spricht viel dafür, dass bei frühesten Störungen die Sprache nur ein Hilfsmedium, aber
nicht zentral ist, und dass es vorrangig um eine direkte affektive Einstimmung geht, so wie sie durch Stern unter dem Begriff
der Regulation von Selbst mit anderem beschrieben worden ist. Dies lässt sich sehr deutlich in der Behandlungen von Patienten mit schweren Grundstörungen erkennen, die nicht auf den Inhalt von Deutungen reagieren, sondern auf die emotionale Qualität der Stimme der Analytikerin. Sie sagen dann beispielsweise: „Es war nicht
wichtig, was Sie gesagt haben. Es war Ihre Stimme, sie ist wie Musik, ich höre sie so gern.“ Diese Patienten sind durch ihre häufig desorganisierten, vermeidenden oder ambivalenten Bindungserfahrungen auf den unveränderlichen festen Rahmen
der Analyse und eine verlässlich zugewandte Analytikerin angewiesen, um erstmals ganz konkret Sicherheit erleben zu
können. Der zeitlich und räumlich feststehende Rahmen stellt für den inneren in der Regel verwirrten, angsterfüllten Zustand solcher Patienten eine externe Regulation dar, die verlässliche Sicherheit bietet. Auf Terminänderungen reagieren diese Patienten daher häufig mit zeitlicher Desorientiertheit, erscheinen zu früh oder zu spät oder am falschen Tag zur Sitzung oder „vergessen“ den Termin. Zu dieser notwendigen Verlässlichkeit kann es gehören, in Paniksituationen als konkret haltende Analytikerin für den Patienten da sein zu
müssen. Um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen, möchte ich betonen, dass dies keinesfalls bedeutet, dem Patienten eine körperliche Berührung anzubieten. Es geht vielmehr um das verlässliche Dasein als Sicherheitsbasis für den Patienten – u.U. in Form telefonischer Kontakte in Urlaubszeiten oder gar einer
konkreten physischen Begleitung in hoch ängstigenden externen Situationen. Dieses Halten „lediglich“ auf einer symbolischen
Ebene anzubieten, erweist sich bei manchen Patienten als unzureichend.

