In „Generation Angst“ untersucht Haidt die psychische Gesundheit der „Generation Z“, also aller zwischen 1995 und etwa 2010 Geborenen, anhand verschiedener internationaler Erhebungen, bei denen Jugendliche zu ihrem Wohlbefinden befragt wurden.
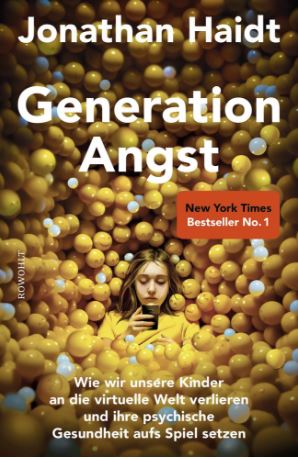
Drei technologische und mediale Megatrends bestimmten die frühen 2010er-Jahre: Smartphones, Social-Media-Plattformen und die Selfie-Kultur. Das Ergebnis: Eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen verwendete mehrere Stunden am Tag darauf, durch die Beiträge von Influencer und mehr oder weniger fremden Nutzern zu scrollen, statt sich mit Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld auseinanderzusetzen, mit ihnen zu spielen, zu sprechen oder auch nur Blickkontakt aufzunehmen. Die Mitglieder der Generation Z, die als erste ihre Pubertät mit den neuen Medien in der Tasche durchlebten, wurden so zu Testpersonen für das Aufwachsen in einer radikal umgestalteten, zunehmend digitalen Umgebung.
Die Folgen dieses Experiments waren, wie Jonathan Haidt auf Grundlage umfangreichen Datenmaterials zeigt, katastrophal – und sie betreffen auch die heute Heranwachsenden. Die schnellste und allumfassendste Neuverdrahtung menschlicher Beziehungen führte dazu, dass sich die mentale Gesundheit der Kinder und Jugendlichen rapide und dauerhaft verschlechtert hat. Dieser Entwicklung müssen wir jetzt entgegentreten: Haidt erklärt, was Regierungen, Schulen und Eltern tun können, um Kindern ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen.
Der Originaltitel lautet: „The Anxious Generation“. Haidt präsentiert dramatische Ergebnisse: eine sprunghafte Zunahme von schweren Depressionen und Angststörungen bei jungen Amerikanern um rund 150 Prozent, also um das Zweieinhalbfache, ab dem Jahr 2010, eine Verdreifachung der Rate von Selbstverletzungen bei Mädchen sowie ein Ansteigen der Suizidrate um 188 Prozent. Referenzwert ist jeweils die Situation junger Menschen vor dem für die Veränderungen entscheidenden Jahr 2010 – als die neue Frontkamera der Smartphones den Boom der Selfies ermöglichte.

Auch ohne smartphone kann man mit anderen Menschen in Kontakt und spannenden Austausch kommen.
„Generation Angst“ ist eine Analyse mit atemberaubender Pointe: die Verfasstheit der jungen Generation sei Symptom einer kollektiven Psychopathologie, die dadurch verursacht wurde, dass junge Menschen in einer besonders vulnerablen Entwicklungsphase mit Systemen sozialisiert wurden, die von ihrer Funktionsweise her allem widersprechen, was den Menschen als Art in den letzten Hunderttausenden von Jahren ausgemacht hat.


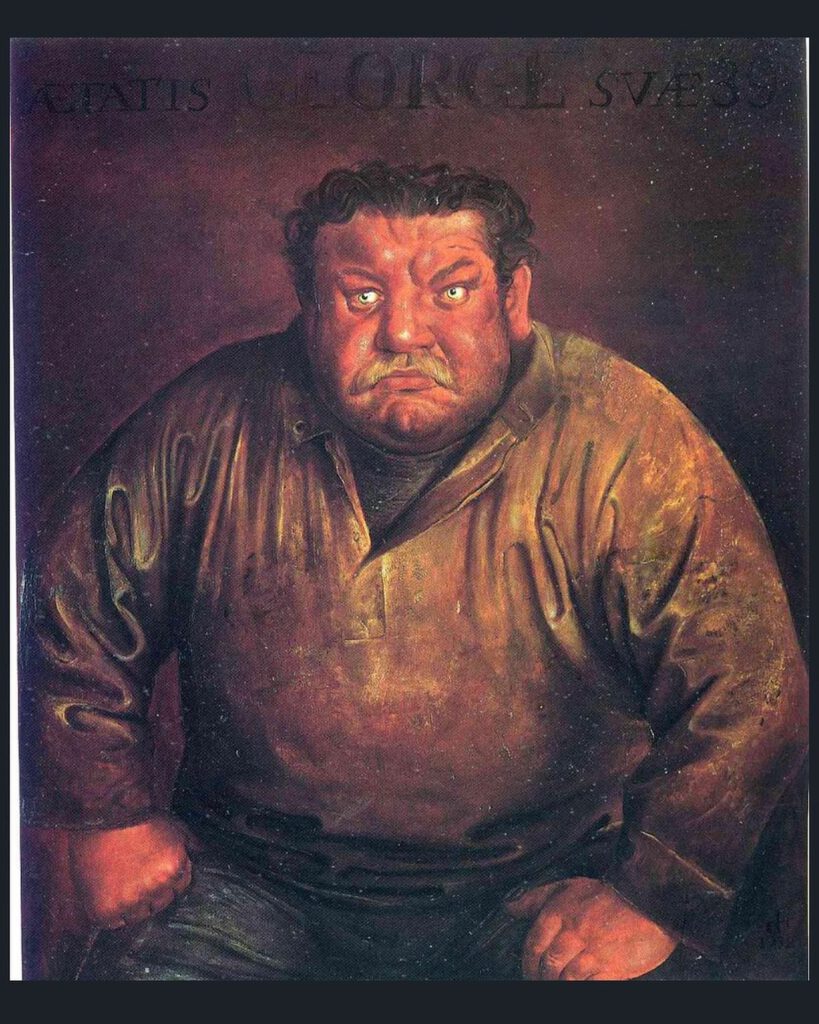



Früher hatte es etwas länger gedauert, bis man ein selfie gemacht hatte. Was nicht zum Nachteil war. – Otto Dix, Portrait of the Journalist Sylvia von Harden 1926; Portrait of the Lawyer Hugo Simons 1925; Portrait of Heinrich George 1932; Portrait of the Poet Ivar von Lucken 1926; Portrait of the Dancer Anita Berber 1925; Self Portrait as Soldier 1914.
Haidt nennt einige Beispiele: Der Mensch sei von jeher ein Wesen, dessen soziale Interaktionen davon gekennzeichnet sind, dass sie „eins-zu-eins“ oder „eins-zu-mehreren“ funktionieren: Man spricht mit einem oder mehreren Menschen und erhält dabei über das, was Haidt „Synchronizität“, also „Gleichzeitigkeit“ nennt, permanent subtile Hinweise über „das richtige Timing“, über die „Wechselseitigkeit“ der Kommunikation. Social-Media-Plattformen hebeln diese urmenschliche Seinsweise aus: indem sie strukturell eine radikal erhöhte Anzahl von „Eins-zu-mehreren“-Kommunikationen ermöglichen (einer postet, Tausende lesen) und gleichzeitig völlig bereinigt von jedem natürlichen Feedback wie Mimik und Körpersprache sind, wirken sie auf uns destabilisierend.

„eins-zu-eins“ oder „eins-zu-mehreren“ – subtile Hinweise hatte man damals schon bekommen.
Haidt argumentiert überzeugend, dass die Einführung bestimmter Technologien mit einem exponentiellen Anstieg psychischer Störungen korreliert. 2010, das Jahr, in dem die psychische Gesundheit vor allem zu dieser Zeit gerade in die Pubertät eingetretener Mädchen sich auf einmal radikal verschlechterte, ist eben das Jahr, in dem das Smartphone seine Frontkamera erhielt, mit der fortan das Selfie seinen Siegeszug in den sozialen Medien antrat.

All das, was für die „Generation Z“ als typisch gilt – etwa ihr ausgeprägter Hang zum Moralismus, wie man ihn in politischen Diskussionen immer wieder bemerkt, oder ihre Vorliebe für Verbote und „Safe Spaces“ – sind Haidt zufolge Symptome von Angststörung und Depression, wie man sie seit Langem aus der Verhaltenstherapie kennt: Depressive Menschen neigen demnach zu „moralischem Schwarz-Weiß-Denken“, zu „starker Verallgemeinerung“, sowie zu Schuldgefühlen. Haidts These ließe sich übrigens mühelos in Einklang mit der aktuell als „Rechtsruck“ beschriebenen Wendung in der politischen Phänomenologie der „Generation Z“ bringen. Ist sie doch durch die gleiche Erratik, den gleichen Pessimismus, die gleiche zugrundeliegende Angst zu erklären.

Frank Bramley (British painter) 1857 – 1915
When the Blue Evening Slowly Falls, 1909
Zwischen 19 und 22 Jahren ist die Einsamkeit besonders groß. Das geht aktuell aus einer aktuellen Umfrage hervor. Junge Frauen und Männer sind unterschiedlich betroffen. Erschreckend hoch sind die Werte bei emotionaler Vereinsamung.
Etwa jeder zehnte junge Mensch in Deutschland fühlt sich sehr einsam. In einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung lag der Anteil der stark einsamen jungen Menschen zwischen 16 und 30 Jahren bei elf Prozent. Werden noch diejenigen hinzugezählt, die sich moderat einsam fühlen, betrifft dies insgesamt 46 Prozent. Im Alter zwischen 19 und 22 Jahren ist die Einsamkeit demnach am größten.
Im Vergleich zu Vorgängerstudien im Pandemie-Jahr 2021 und im vergangenen Jahr fühlen sich aktuell demnach etwas weniger junge Menschen sozial und emotional einsam. Der Anteil der emotional Einsamen lag 2024 bei 60 Prozent, wobei bei 14 Prozent dieses Gefühl stark ausgeprägt war. Der Anteil der sozial Einsamen lag bei 39 Prozent, zehn Prozent litten stark darunter.
Junge Frauen sind der Umfrage zufolge häufiger von Einsamkeit betroffen als junge Männer. Das gilt auch für junge Menschen, die geschieden, verwitwet oder arbeitslos sind, einen niedrigen Schulabschluss haben, in mittelgroßen Städten leben oder einen Migrationshintergrund haben. Diese besonders einsamen Gruppen berichteten in der Bertelsmann-Umfrage häufig auch von einer besonders geringen Lebenszufriedenheit.

Früher war die Einsamkeit für junge Frauen auch ein Problem, aber nicht das wichtigste.

