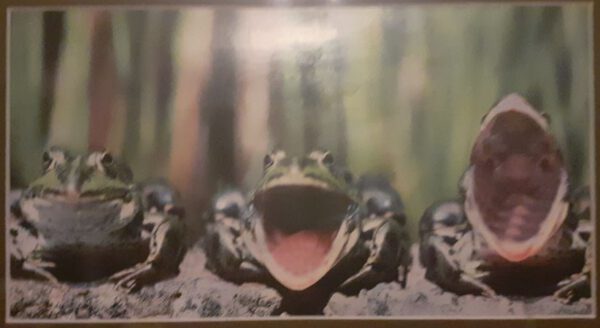Warum Singen gesund und attraktiver macht: dass gemeinsamer Gesang eine Gruppe stärkt, weiß der Mensch seit Anbeginn der Zivilisation. Doch Singen macht nicht allein gesellig und glücklich – nach neuen Erkenntnissen wirkt es wie ein Wundermittel auf Körper und Geist. Offenbar hat es sogar eine messbare erotische Komponente.
Wir tun es schadenfroh, wenn der FC Bayern im Pokal verliert, mitfühlend für andere, einsam vom Balkon oder andächtig, wenn wir uns in der Kirche oder wo auch immer an unsere jeweiligen Götter wenden: Wir singen.
Der Mensch und der Gesang gehören zusammen. Er, der Gesang, ist überall, er ist gesund. Aber warum ist das so? Warum singen wir so gern und überhaupt? Woher kommt der Gesang? Was haben unsere Vorfahren damit zu tun? Und sollten wir alle mehr singen?
Beantworten wir die letzte Frage zuerst: Ja, wir sollten immer noch mehr singen, als wir es so schon tun. Denn der menschliche Gesang ist so etwas wie unser hauseigener Opiat-Dealer. Nur ohne die schädlichen Nebenwirkungen für unser Gehirn und für die Geldbörse, sondern, im Gegenteil, weitgehend umsonst und überaus heilsam.
„Die ersten Studien, die dazu vor Jahren gemacht wurden, beruhen auf Selbstberichten“, erklärt Gunter Kreutz, Musikwissenschaftler an der Universität Oldenburg. Kreutz ist Autor des Buches „Warum Singen glücklich macht“. In seiner Forschung hat er sich auf die Bedeutung, die gemeinsamer Gesang, gemeinsames Tanzen und gemeinsames Musizieren auf Laien hat, spezialisiert. „Man hat Leute in einem Chor befragt, was ihnen das Singen überhaupt bringt. Denen ist dazu am ehesten eingefallen, dass es ihre Körperhaltung und Stimme verbessert sowie Stress lindert und Entspannung hervorruft.“
Ein Grund, warum Singen nicht nur sprichwörtlich glücklich macht: Gesang ist eine sportliche Aktivität. Die körperlichen Anstrengungen, die dazugehören, die Kontrolle, die man über die Stimmbänder erlangen muss, um den richtigen Ton zu treffen, das Füllen der Lungen mit Luft, die Bewegungen von Mund und Körper sind mitverantwortlich dafür, warum Singen unsere Laune hebt. Wie beim Sport setzt das Gehirn beim Singen Endorphine frei, wir fühlen uns glücklicher. Und wer zufrieden ist, lebt wiederum gesünder.
Ob sogar jene am gesündesten leben, die am besten die Töne treffen, hat wiederum die Universität Melbourne untersucht. Im Rahmen einer Studie wurden die Gehirne von professionellen Sängern, Amateur-, Gelegenheits- und Nicht-Sängern mithilfe eines MR-Scanners während des Singens verglichen.
Die schlechte Nachricht für die meisten von uns: Während bei Profi- und Amateursängern beide Gehirnhälften – sowohl die für die Sprache, als auch die für die Musik – angesprochen werden, hat man bei Studienteilnehmern, die angegeben haben, nicht singen zu können, lediglich Aktivitäten in dem Teil des Gehirns feststellen können, der für die Sprache verantwortlich ist. Bei Rechtshändern ist das meist die linke, bei Linkshändern meist die rechte Gehirnhälfte. Je besser wir singen, desto besser vernetzt sich unser Gehirn – und belohnt uns dafür mit der Ausschüttung von Dopamin. Das ist der Deal.
Wie im Sport konzentrieren wir uns auch im Gesang auf unsere Atmung – die effizienteste Anti-Stress-Strategie, die uns als Menschen zur Verfügung steht. Aktuelle Studien haben ergeben, dass die Konzentration auf das Atmen Teile des Gehirns aktiviert, die im engen Zusammenhang mit der Regulierung von Emotionen, Aufmerksamkeit, Konzentration und der eigenen Wahrnehmung stehen.
Aber warum? Warum belohnt uns die Evolution, wenn wir gut singen? Warum singen wir überhaupt? „Es gibt eine Reihe von Ursprungstheorien zum menschlichen Gesang, mit einer entscheidenden Gemeinsamkeit: Er bringt Menschen zusammen“, erklärt Gunter Kreuz. „Wenn mehrere Menschen zusammen in einem Raum sind, bedeutet das noch lange nicht, dass sie sich auch wahrnehmen. Aber wenn sie zusammen singen, dann bilden sie eine Gemeinschaft.“
Wenn wir eine Gemeinschaft formen, fühlen wir uns wohl. Schon biochemisch: Wenn wir uns anderen Menschen besonders verbunden fühlen oder Vertrauen zu ihnen aufbauen, schüttet unser Gehirn Oxytocin aus, das körpereigene „Kuschelhormon“. Besonders nah sind wir uns, wenn wir gemeinsam singen. Wie schon unsere Vorfahren.
War der Gesang als solcher eine Wahl, die wir hatten, oder eine evolutionäre Notwendigkeit? Handelte es sich beim ersten Gesang der Menschheit eher um eine Art des sexuellen Lockruf, als um einen melodischen Vortrag? Bereits Charles Darwin – dem die Absonderlichkeit dieser Ausdrucksform, der Musik, speziell der menschlichen, nach eigener Aussage ein Rätsel war – hat vermutet, dass Musik und Gesang die Resultate eines sexuellen Selektionsprozesses gewesen sein könnten. Und obwohl bis heute keine Studien existieren, die diese These empirisch belegen könnten, gibt es immer wieder Erkenntnisse über die Zusammenhänge von Musik und Sex. An der Universität Wien etwa haben Forscher herausgefunden, dass Frauen dazu tendieren, die Gesichter von Männern als attraktiver wahrzunehmen, wenn sie vorher musikalisch stimuliert wurden.
Der schwedische Neurowissenschaftler Björn Merker nimmt in seinem bereits 2001 erschienenen Essay „Synchronous Chorusing and Human Origins“ (Gemeinsames Singen und der Ursprung der Menschheit) an, dass Gesang, Musik, Sprache und der moderne Mensch in seinem Kern ein und demselben, auf den Sexualtrieb zurückzuführenden Mechanismus entsprungen sein könnten: den synchronisierten, chorähnlichen „Gesängen“ der Schimpansen.
Lange, bevor sich die ersten Menschen zusammenfanden, um gemeinsam ihre Götter oder Geister anzusingen, haben sich männliche Schimpansen in Gruppen organisiert, um mit rhythmischen Gruppenrufen Weibchen anzulocken. Die Resonanz von individuellen Affenlauten, dieser frühe „Chor“ als musikalischer Puls, war die erste Basslinie in der Kulturgeschichte der Primaten und signalisierte die Größe und die Kooperationsbereitschaft einer Gruppe, auch über weite Entfernungen hinweg. Dass Männchen gut gemeinsam singen konnten, war für Weibchen existenziell.
Ob wir nun aber singen, weil schon prähistorische Schimpansen „sangen“? So oder so: Häufig trauen wir uns einfach nicht. Gunter Kreutz: „Alle Menschen sind zum Singen geboren. Wir alle haben eine Lunge und einen Rachenraum, in dem die Töne hallen können. Nur fühlen sich die meisten Menschen leider nicht danach.“
Genauer gesagt, fühlen wir uns nicht mehr danach, wenn wir erst einmal erwachsen geworden sind. Für kleine Kinder ist Singen, auch unbemerkt von den Erwachsenen um sie herum, alltäglich. „Manchmal tun sie es ganz leise, versteckt unter dem eigenen Atem, und manchmal ganz laut, um den Raum zu füllen. Ihr Gesang steht immer im Einklang mit dem, was sie gerade tun, und kann entweder nach innen oder nach außen gerichtet sein“, schreibt die britische Autorin Bronya Kerrin Dean in ihrer Dissertation zum Thema: Der Gesang von Kindern lasse sich besser beschreiben als eine Form „musikalischen Sprachverhaltens“ und bewege sich irgendwo zwischen Summen, tatsächlichem Singen und einer verspielten Nutzung der eigenen Stimme. Es sei nicht unüblich, dass Kinder bis zu zehn Prozent ihres Alltags in der ein oder anderen Form singend verbringen.
Und dann werden wir erwachsen: „Wir tragen dieses Musikinstrument ein Leben lang mit uns herum, ob wir wollen oder nicht. Und wir nutzen es eigentlich auch recht fleißig, am fleißigsten allerdings in der Kindheit“, sagt Gunter Kreutz. „Von vielen Menschen wird das Singen vergessen und verdrängt, von einigen aber im Lauf des Lebens wiederentdeckt, was ihnen so guttut, dass sie sich fragen, warum sie in ihrem Leben nicht mehr gesungen haben.“
Der Schlüssel zum menschlichen Gesang und zur Musik steckt auch in der Reinheit ihrer Natur. So jedenfalls postuliert es der amerikanische Musikwissenschaftler Bruno Nettl. In seiner eigenen Ursprungstheorie zur Entstehung der Musik schlägt er vor, dass Musik, angefangen mit dem eigenen Gesang, aus einer undifferenzierten Methode zur Kommunikation heraus entstanden sein könnte, die weder Sprache noch Musik war, aber bereits über dynamische Tonhöhen, über unregelmäßige Muster der Betonung und über eine variable Dauer der Töne verfügt hat. Hieraus sei dann, durch Vokale und Konsonanten, die Sprache, und durch die später erlernte Fähigkeit, Tonhöhen zu halten und dem Vortrag eine Form zu geben, die Musik entstanden.
„Dieser Vorgang spiegelt, bis zu einem gewissen Grad, die Entwicklung von der Kindheit über die Jugend bis zum Erwachsenenalter“, schreiben der britische Sänger John Potter und französische Musikwissenschaftler Neil Sorrell in ihrem Buch „A History of Singing“. Sie beziehen sich dabei auf Nettls Theorie und führen aus: „Eine Interpretation dieses Prozesses könnte sein, dass sich die Geschichte des Gesanges in dem Lebenszyklus eines jeden einzelnen Menschen fortlaufend wiederholt.“ Aber natürlich ist das wieder nicht mehr als eine reine Vermutung, wenn auch eine besonders schöne.
Wir wissen nicht, warum wir singen, aber wir wissen, dass es uns guttut – und dass wir mehr singen sollten. Wir alle kennen sie, solche Momente, wenn die Jukebox in der Kneipe ein Lied wie „Angels“ von Robbie Williams spielt und sich Freunde und Fremde summend oder sogar singend bildlich oder wörtlich in den Armen liegen. Und sich alle fragen: Warum nicht noch viel öfter so?