Taugt die Philosophie als Lebenshilfe oder steht sie dem wahren Leben im Weg? Adèle Van Reeth, Star des französischen Kulturfernsehens, fürchtet, dass der digitale Mensch den Bezug zur Realität verliert. Ein Gespräch über die Suche nach der Wirklichkeit des Lebens.
Die französische Journalistin Adèle Van Reeth, Autorin eines Buch mit dem programmatischen Titel „La Vie ordinaire“ (Das normale Leben), hat sich mit ihrer Sendung „Les Chemins de la philosophie“ (Die Wege der Philosophie) auf France Culture für eine im Alltag verankerte Philosophie stark gemacht. Wir haben mit ihr über schwindende Realitäten im digitalen Zeitalter gesprochen – und über neue Wege in eine veränderte Wirklichkeit.
WELT: Sie haben rund zwölf Jahre lang die Sendung „Les Chemins de la philosophie“ (Die Wege der Philosophie) bei France Culture produziert. Sie hatte unter anderem das Ziel, die Philosophie für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. Glauben Sie, dass wir alle mehr Philosophie in unserem Leben brauchen?
Adèle Van Reeth: Ich möchte die Philosophie nicht etwa auf ein Schulfach reduzieren, das in der Oberstufe, an der Universität oder in Büchern gelehrt wird. Ich sehe in der Philosophie eine Art und Weise, über die Welt zu reflektieren, und als Möglichkeit, einen Zugang zur Realität zu finden. Und wenn man es so sieht, so ist die Philosophie wirklich für jeden hörbar und sichtbar. Sicherlich fehlt es uns an den entsprechenden Medien, die uns diesen Zugang verschaffen. Ich habe jedoch auch festgestellt, dass viele Menschen, die nie Philosophie studiert haben, aufgrund ihrer Art und Weise, sich auszudrücken, zu denken oder sich Fragen zu stellen, eine philosophische Herangehensweise haben. Und ich verstehe unter „philosophisch“ auch nicht die reichlich überstrapazierte Aussage, jemand habe eine „gute Lebensphilosophie“ oder eine bestimmte Art des Denkens. Es bedeutet ganz einfach, über die Tatsache zu staunen, dass es die Dinge gibt.
WELT: In Ihren Büchern „La Vie ordinaire“ (Das normale Leben) und „Inconsolable“ (Untröstlich) erzählen Sie von zwei Ereignissen – der Geburt eines Kindes und dem Verlust eines Angehörigen – bei denen die Philosophie Ihnen keine Hilfe war. Marguerite Yourcenar schreibt, dass „man wie eine Jungfrau zu all den Ereignissen im Leben kommt“: Kann einen die Philosophie nicht doch darauf vorbereiten, wie man mit solchen Schicksalsschlägen leben sollte?
Van Reeth: Ich glaube nicht. Und genau deswegen habe ich ja auch diese Bücher geschrieben. Was nützt es mir, wenn ich mich zwanzig Jahre lang mit solchen philosophischen Texten beschäftige, sie mir dann aber in dem Moment, in dem ich sie bräuchte, keinerlei Hilfe sind? Genau dieser Frage wollte ich auf den Grund gehen, und genau das brachte mich dann zum Schreiben.
Die Geburt ist ein Thema, das in philosophischen Texten nie auftaucht. Platon sagt zwar, die Philosophie sei eine Art Geburtshelfer, aber nur des Geistes. Der schwangere Körper, der gebärende Körper und auch der stillende Körper kommen in der Geschichte der Philosophie nicht vor, zweifellos weil die Männer und Frauen, die als Philosophen in die Geschichte eingegangen sind, diese Erfahrung nicht gemacht hatten. In „La Vie ordinaire“ nehme ich, als die Skeptikerin, die ich bin, Descartes beim Wort: Für ihn besteht die einzige Grenze des Zweifels in der Existenz Gottes. Für mich ist es die Existenz eines Embryos im Inneren meines Körpers. Ich kann an meiner eigenen Existenz nicht zweifeln, weil ich Leben in mir trage … Das verändert alles! Ein Kind zu erwarten, das bedeutet eine zweifelsfreie Existenzgrundlage. Und man braucht kein Philosophiestudium, um sich mit dieser Erfahrung identifizieren zu können.
Bei dieser ersten Erfahrung war die Philosophie also keine Hilfe, denn sie war stumm. Bei der zweiten, dem Tod meines Vaters, war es fast das Gegenteil: Ich stellte fest, dass es fast zu viele Referenzen und Texte über den Tod gab, der ja das philosophische Thema schlechthin darstellt. Und dennoch stellte ich wieder fest, dass ein philosophisches Reflektieren hier sinnlos war. Man sagt oft, dass einen die Philosophie lehrt zu sterben, tatsächlich jedoch bereitet uns nichts auf den Tod eines anderen Menschen vor. Also kehren wir zurück zur Ausgangsfrage: Wozu sind all diese Autoren nütze? Ich versuche, dieses „Wozu“ nun fruchtbar zu machen, und ich glaube, dass etwas Philosophisches in diesem Drang steckt, weiter nachzugraben. Die Philosophen, die mir wirklich viel bedeuten, sind für mich ausgesprochen anregende Lebensgefährten, die mich ebenso sehr aufregen können, wie sie mich faszinieren.
WELT: Ein bedeutendes philosophisches Werk der Spätantike ist „Der Trost der Philosophie“ von Boethius. In Ihrem Buch jedoch schreiben Sie, dass man angesichts bestimmter Nachrichten „untröstlich“ sein kann. Kann uns denn die Philosophie nicht doch Trost bringen, wenn sie uns auch nicht vorbereitet?
Van Reeth: Ich glaube nicht, dass die Philosophie tröstet, wenn man unter diesem Trost etwas versteht, das uns unsere Tränen trocknet. Ich habe eine beinahe entgegengesetzte Vorstellung von der Philosophie: Ich liebe an der Philosophie liebe, dass sie mich absolut klarsehen lässt. Statt meine Tränen zu trocknen, lässt sie mich den Finger auf die Wunde legen, auf all das, was ich vor mir selbst verberge und was zu schwer zu akzeptieren ist. Doch genau damit hilft sie mir zu leben. Ich sehe die Philosophie als eine Art von Zugang zur obersten Realität, ohne jede Ebene der Verdrängung. Statt nur Trost bringt die Philosophie die Erkenntnis, die meiner Ansicht nach das beste Viatikum ist, um wirklich zu existieren.
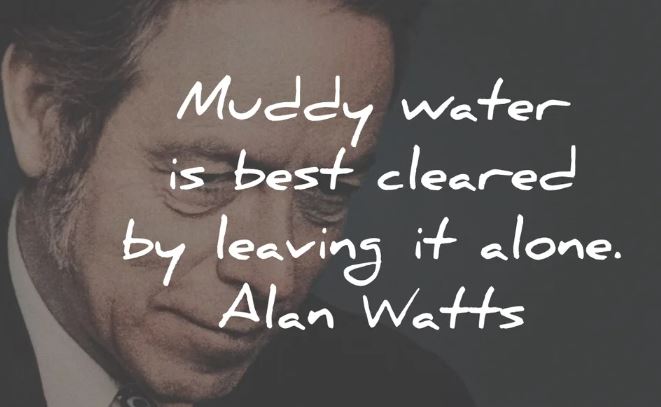
Ein weiteres unverzichtbares Instrumentarium auf dem Streben nach Klarheit und Erkenntnis.
WELT: Sehen Sie in diesem Streben nach Klarheit und der Erkenntnis der Wirklichkeit die Philosophie als Alternative zu den Bildschirmen, als Hilfsmittel zum Abschalten?
Van Reeth: Die Philosophie bietet eine Annäherung an die Realität, die die Bildschirme übertrifft, wenn man den „Bildschirm“ im metaphorischen Sinne als das ansieht, was uns von der Welt wegführt. Dieses Arbeiten an der Einsicht, die die Philosophie ausmacht, besteht ja genau darin, dass wir die Schutzschirme entfernen, die wir zwischen uns und der Welt aufgebaut haben, damit wir den Dingen nicht ins Gesicht sehen müssen. Zu philosophieren bedeutet nicht, dass man sich in abstrakte Konzepte flüchtet. Im Gegenteil, es bedeutet, den Mut zu haben, sich mit dem Unmittelbaren auseinanderzusetzen. Die Philosophie ist eine Rückkehr in die Wirklichkeit. Und das ist das beste Mittel gegen das Weglaufen. Sie besteht darin, diese Bildschirme zu durchbrechen und sich wieder der Realität zuzuwenden.
WELT: Muss man die Bildschirme als einen neuen Avatar der Schatten sehen, den man in der Höhle Platons findet?
Van Reeth: Das kann man, unter der Voraussetzung, dass man den Bildschirm nicht als ein geringeres Etwas betrachtet. Ich glaube, dass ein Bildschirm, eine Illusion, ein Schatten oder ein Film genauso zur Realität gehören wie die Welt der Ideen. In dieser Hinsicht bin ich absolut keine Anhängerin Platons, denn ich bilde keine Hierarchie zwischen den verschiedenen Existenzformen: Eine Kopie ist nicht weniger echt als sein Original, unser Leben auf dem Bildschirm nicht weniger real als unser Leben ohne die Bildschirme. Wir sind mittlerweile alle vollständige digitale Wesen, und das muss in unser Denken integriert werden, ohne jegliche moralische Wertung.
WELT: Können die klassischen Philosophen uns dabei helfen, auch über die aktuellen Fragen wie Hypervernetzung oder den zeitgenössischen Individualismus zu reflektieren – oder sollte man da eher die modernen Philosophen zurate ziehen?
Van Reeth: Platon und Descartes, um hier nur zwei zu nennen, haben uns definitiv auch heute einiges zu sagen. Denn wenn die Philosophie auch in unserem Alltag verankert ist, erfasst sie vor allem eine Unveränderlichkeit des menschlichen Daseins. Und das führt dazu, dass wir uns letztendlich dieselben Fragen stellen wie beispielsweise Heraklit im 6. Jahrhundert vor Christi Geburt.
Es hat natürlich technische Fortschritte gegeben, und das digitale Zeitalter, in dem wir heute leben, ist vollkommen anders als das antike Griechenland. Und dennoch sind die Fragen, die sich die klassischen Philosophen damals stellten, nach all dieser Zeit, ebenso aktuell und relevant bezüglich der menschlichen Natur, unserem Bedürfnis nach einem Sinn des Lebens, und das vollkommen unabhängig von der jeweiligen Epoche. Sie sprechen vom digitalen System: Henri Bergson hat viele Seiten lang über das Virtuelle geschrieben. Und Gottfried Wilhelm Leibniz über die Unendlichkeit aller möglichen Welten.
Die Philosophie macht ja keine Fortschritte. Aber ich glaube, dass die Kraft der zeitgenössischen Philosophen darin besteht, dass sie sowohl über eine enorme Kenntnis der Philosophiegeschichte verfügen als auch über eine sehr genaue Vorstellung von ihrer eigenen Zeit. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Jemand, der die eigene Epoche sehr gut kennt, aber nie ein philosophisches Buch gelesen hat, könnte wohl kaum eine eigene philosophische Abhandlung fertigbringen. Und auch umgekehrt würde es wohl jemandem, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, seine Nase in philosophische Bücher zu stecken, dabei aber die eigene Epoche nicht wirklich kennt, sehr schwerfallen, einen wirklich relevanten Gedanken zu formulieren.
WELT: Marguerite Yourcenar schreibt über die Kompatibilität der Philosophie mit unserem Alltag in ihrem „L‘Œuvre au noir“ („Die schwarze Flamme“): „Der Weg des Geistes, der sich auf der Kehrseite der Dinge einen Weg bahnt, führt sicher zu erhabenen Tiefen, macht aber die eigentliche Übung, die im Sein besteht, unmöglich.“ Ist die Philosophie mit dem Leben nicht vereinbar?
Van Reeth: Ich kann mich mit diesem Satz von Marguerite Yourcenar vollkommen identifizieren – und glaube dennoch, dass ich Unrecht habe. Ich verbringe mein Leben – auch wenn es sich gerade verändert – mit der Sorge, dass die geistige Arbeit mich von der Wirklichkeit entfernt. Ich bedauere das, weil ich denke, dass es nicht richtig ist, aber ich kann nicht anders, ich glaube, dass die Zeit, die ich damit verbringe, nachzudenken und zu schreiben, Zeit ist, die ich nicht mit meinen Kindern oder Freunden verbringe, nicht zum Joggen gehe oder all die anderen Dinge tue, die ich liebe. Ich habe manchmal sogar den Eindruck, dass die Liebe zum Leben selbst dem Denken im Weg stehen kann.
Und gleichzeitig ist mir klar, dass das Denken gerade von dieser Liebe zum Leben genährt wird. Meine ganze Arbeit besteht darin, die Philosophie und das tägliche Leben nicht voneinander zu trennen. Darin steckt eine Ambivalenz, die ich wirklich faszinierend finde: Man muss im Grunde dafür sorgen, dass das eine nicht zum Hindernis für das andere wird, denn ich möchte wirklich nicht gerne wählen müssen.
WELT: Spüren Sie in ihrem Familien-Alltag, beim Erziehen Ihrer Kinder, auch so etwas wie ein Vermitteln der Philosophie?
Van Reeth: Mit meinen Kindern habe ich eine sehr primäre, fast animalische Beziehung, die nicht im Geringsten vom Denken geprägt ist, und genau das liebe ich. Meine Kinder sind noch klein, ich versuche, ihnen die Lust am Leben im Allgemeinen zu vermitteln, nicht die an der Philosophie im Besonderen. Ich selbst habe es wie einen Gewinn an Unabhängigkeit und Selbstständigkeit erlebt. Ich möchte meine Kinder zunächst in der Wirklichkeit verankern, damit sie dann tun können, was sie wollen. Ein Vermitteln von Denkfähigkeit hat keinen Sinn, wenn sie nicht auch mit der Freude am Dasein einhergeht.

