Die Differenziertheit und Komplexität der inneren Gefühlswelt ist ein charakteristisches Grundmerkmal der menschlichen Spezies. Gefühle sind– neben den kognitiven Fähigkeiten– der neurobiologische Ersatz für die Instinkte bzw. deren Ergänzung. Sie ermöglichen die Orientierung in der mitmenschlichen und kulturellen Umwelt, die sich der Mensch selbst immer wieder neu erschaffen muss.
Der Mensch teilt seine Gefühle dem anderen mit, vor allem durch die Mimik, aber auch durch Gestik, Körperhaltung, Tönung und Lautstärke der Stimme sowie viele weitere nonverbale Signale und schließlich auch über die Sprache. Im Laufe der Evolution hat der Mensch ein spezielles Sensorium, ein sehr feines Gespür für die Emotionen anderer Menschen entwickelt– und zwar, indem er seine eigenen Gefühlsreaktionen registriert. Dies geschieht zum allergrößten Teil unbewusst. Die Psychoanalyse hat dafür den Begriff der Gegenübertragung geprägt, aber dieses Phänomen spielt nicht nur in therapeutischen Zusammenhängen, in denen es entdeckt wurde, eine Rolle, sondern ist ein zentraler Steuerungsmechanismus in unser aller Leben. Der Mensch registriert nicht nur seine eigenen Gefühle, sondern er beobachtet auch das Verhalten, die Mimik und den sonstigen Ausdruck seiner Mitmenschen. Er versucht fortlaufend, sich eine Vorstellung davon zu machen, was der andere fühlt, denkt, weiß und wünscht und was er dementsprechend als nächstes tun wird.
Diese Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen und seine Emotionen zu lesen, haben Peter Fonagy und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den letzten Jahrzehnten unter dem Begriff der Mentalisierung genauer untersucht. Mit »mentalisieren« ist gemeint, dass man eigene Vorstellungen davon bildet, durch welche Gefühle, Einstellungen, Wünsche und Überzeugungen das Verhalten des anderen motiviert ist. Diese einzigartige Fähigkeit, sich in die Gefühls- und Gedankenwelt anderer hineinzuversetzen, hineinzudenken und einzufühlen, eröffnet dem Individuum eine innere Welt, in der die äußere Welt der sozialen Beziehungen und die psychische Welt der Mitmenschen repräsentiert ist. Wenn ich mentalisieren kann, muss ich das Verhalten eines anderen Menschen nicht mehr für bare Münze nehmen, sondern die Bedeutung dessen, was der andere sagt und tut, muss von mir interpretiert werden und erschließt sich mir erst, indem ich mich in ihn hineinversetze, um seine Motive zu ergründen. Die Beziehung zum anderen wird dadurch vielgestaltiger, differenzierter und einfühlsamer– und führt nicht zur sofortigen platten Reaktion, sondern eher zu Nachfragen, ob ich mit meinen Vermutungen den anderen auch richtig verstanden habe. Mentalisieren fördert also den kommunikativen Austausch mit anderen, verringert Missverständnisse und eröffnet Konfliktlösungen durch Verständnis und Verständigung. Dass Empathie auch dazu genutzt werden kann, den anderen für eigennützige Interessen zu instrumentalisieren, ist nur eine weitere Facette der anthropologisch gegebenen Einfühlungsfähigkeit– dies sind die »dunklen Seiten der Empathie« (Breithaupt, 2017).
»Empathie beinhaltet zum einen die Fähigkeit, die Gefühle, Gedanken und Absichten eines Mitmenschen zu erkennen« (Roth & Strüber), eine Fähigkeit, die »Theory of Mind« (»Theorie des Geistes«) genannt wird.
Seit dem Altertum wird das Gehirn als Organ der Seele angesehen. Wo und wie aber das Psychische im Gehirn entsteht, wie sich dabei unsere Gefühlswelt, unsere Persönlichkeit und unser Ich formen, kann mit Hilfe der modernen Verfahren der Hirnforschung erst seit kurzem erforscht werden und wird in diesem Buch dargestellt.
Die jüngsten Fortschritte der Neurowissenschaften in Kombination mit modernen Forschungsmethoden machen es möglich, fundierte Antworten darauf zu geben,
– wo im Gehirn die Seele zu verorten ist
– wie der Aufbau der Persönlichkeit verläuft
– worauf psychische Erkrankungen beruhen
– warum die Wirksamkeit von Psychotherapien nicht gut belegt ist
– warum alte Muster immer wieder unser Verhalten bestimmen und so schwierig zu verändern sind
– warum Menschen mit antisozialen Persönlichkeitsstrukturen nur schwer behandelbar sind
– wie man im Rahmen der Psychotherapie oder mit Medikamenten auf die Psyche einwirken kann.
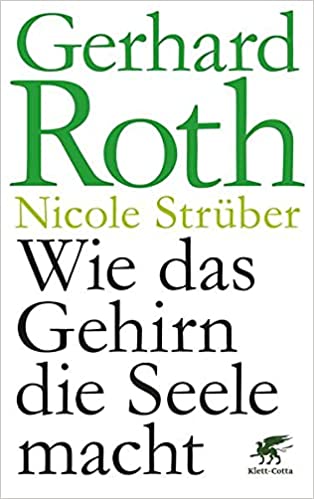
Zum anderen ist damit »die Fähigkeit zum ›Mitleiden‹, die emotionale Empathie« (ebd.) gemeint. Die Fähigkeit, die Gefühle, Gedanken und Absichten eines Mitmenschen zu erkennen, kann durchaus vorhanden sein, ohne dass die Fähigkeit zum Mitleiden bestünde.

Der Psychologe Paul Ekman entdeckte in den 1960er Jahren, dass bestimmte Emotionen überall auf der Welt gleich sind und von jedem Menschen verstanden werden können. Ekman studierte Video-Aufnahmen von Urvölkern und stellte fest, dass ihm die meisten der Gesichtsausdrücke bekannt sind und dass er diese einer bestimmten Emotion zuordnen kann.
Ekman konnte beweisen, dass es sieben Basisemotionen gibt, die durch eine bestimmten Mimik ausgedrückt werden.
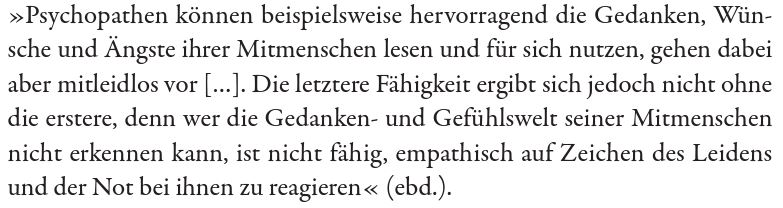
Parallel zur mentalisierenden Einfühlung in die Seele anderer entwickelt sich auch die Fähigkeit, die eigenen inneren Gefühle, Affekte und Impulse zu mentalisieren. Das wiederum eröffnet die Chance, die eigenen Gefühlszustände zu modellieren und zu regulieren. Wer seine Affekte mentalisiert, ist ihnen nicht mehr ohnmächtig ausgeliefert und muss sie nicht eins zu eins in reales Handeln umsetzen. Unsere eigenen Gefühle haben dabei zwei Aufgaben: Zum einen teilen wir dem anderen mithilfe unserer Mimik und all den anderen nonverbalen und verbalen Signalen mit, was uns innerlich bewegt– das ist die Ausdrucksfunktion der Gefühle–, zum anderen können wir mithilfe unserer Gefühle aber auch erfassen, was den Mitmenschen innerlich beschäftigt– das ist die Wahrnehmungs- oder Erkenntnisfunktion unserer Gefühle.

Mikroexpressionen zeigen die wahren Gefühle
Wie helfen Paul Ekmans Erkenntnisse im Alltag? Im täglichen Trott sind wir darauf programmiert, unsere Gefühle zu verbergen. Es wird gelächelt, obwohl es einem nicht gut geht. Es wird zugestimmt, obwohl man Ablehnung empfindet. Doch die Gesichtsmuskulatur ist direkt mit dem limbischen System, dem Emotionszentrum, verbunden. Damit ist es nicht möglich, die Gefühle gänzlich zu verstecken.
In einem Gesichtsausdruck, der kürzer ist als die Dauer eines Wimpernschlags, blitzen Gefühle für einen Moment auf. Das sind die sogenannten Mikroexpressionen.
Sie treten zutage, weil das limbische System Informationen schneller verarbeitet als das Großhirn und uns damit die Steuerung der eigenen Gefühle für einen Moment entreißt. Unkontrollierbar spiegelt sich auf dem Gesicht für einen Augenblick die Wahrheit, die wir wirklich empfinden. Erst danach kann wieder die Maske aufgesetzt werden.
Besonders in Situationen, die einen emotional berühren, wenn es beispielsweise um ein Thema geht, das einem wichtig ist, treten Mikroexpressionen verstärkt auf. Ein Widerspruch in dem, was jemand sagt, und dem, was jemand denkt und fühlt, zeigt sich nur in diesem kurzen Moment.
Das ist das, was man allgemein als „Bauchgefühl“ oder „Intuition“ kennt. Es ist jedoch nichts mystisches, sondern klar wahrgenommene, schnelle Signale im vorbewussten Bereich. In hochaufgelösten Videosequenzen sind diese klar erkennbar.
Psychosoziale Entwicklungsprozesse, Erziehung und Sozialisation bestehen in einem beträchtlichen Ausmaß im Erwerb der Fähigkeit, Affekte zu regulieren und Gefühle zu mentalisieren– sowohl die eigenen als auch die Gefühle von anderen. Folgt man dem Neurowissenschaftler Antonio Damasio, dann entfalten die Gefühle ihre »vollständige und andauernde Wirkung« erst, wenn sie bewusst gemacht sind, wenn wir nicht nur Gefühle haben, sondern auch wissen, dass wir sie haben und was sie ausdrücken und bedeuten: »Das Bewusstsein macht Gefühle der Erkenntnis zugänglich und unterstützt damit die innere Wirkung von Emotionen. Es versetzt diese in die Lage, den Denkprozess durch Vermittlung des Fühlens zu durchdringen« (ebd., S.74).
Woher wissen wir, dass wir wissen? Wie entsteht das Gefühl für unser Selbst? Welche Rolle spielen Emotionen und Gefühle im Bewusstseinsprozess? In einer klaren, gut verständlichen Sprache beschreibt der weltweit berühmte Neurologe Antonio Damasio, warum wir fühlen, was wir sind. Zahlreiche Fallbeispiele aus seinem Patientenkreis veranschaulichen dabei, welch kuriose und schreckliche Folgen Schädigungen des Gehirns für unser Selbstverständnis haben können. Eine spannende Reise in die Tiefe unseres Bewusstseins.

Da Emotionen »untrennbar verbunden [sind] mit der Idee von Gut und Böse« (ebd., S.72), besteht eine ihrer wesentlichen Funktionen darin, Bewertungen nach moralischen Kriterien vorzunehmen. Demnach basiert das moralische Bewusstsein, über das nur der Mensch verfügt, nicht ausschließlich auf dem Verstand, sondern fundamental auf Gefühlen. Gefühle sind unser ständiger Begleiter. Mehr oder weniger alle Objekte und sozialen Situationen in unserer Umgebung lösen mehr oder weniger starke Emotionen in uns aus. Wir können gar nicht anders, als emotional zu reagieren. Da wir unserer Körperlichkeit nicht entfliehen können und deren Signale unsere emotionale Gestimmtheit unablässig beeinflusst, sind wir auch unseren Emotionen mehr oder weniger passiv ausgeliefert, insbesondere denen, die nicht ins Bewusstsein dringen. Der Philosoph Helmuth Plessner hat eine Unterscheidung zwischen Körperhaben und Leibsein (1970, S.43), getroffen, die sich unmittelbar auf die Gefühle übertragen lässt. Der Mensch hat einen Körper, indem er ihn beherrscht, gebraucht, inszeniert und instrumentell einsetzt. Man kann aber auch sagen: Der Mensch hat Emotionen, die er beherrschen, gebrauchen, inszenieren und instrumentell einsetzen kann. Jedoch zugleich – und genau genommen primär– ist der Mensch ein Universum von Gefühlen, denen er nicht entfliehen kann. Gefühlen kommt ein Widerfahrnis-Charakter zu. Wir müssen sie in der Regel erst erfahren und wahrgenommen haben, um sie dann verarbeiten und beeinflussen zu können. Und wenn Sigmund Freud formulierte »Das Ich ist vor allem ein körperliches«, könnte man auch sagen: »Das Ich ist vor allem ein emotionales.«

Dieser Beitrag ist ein Auszug aus „Gefühle machen Politik“.
Gefühle haben großen Einfluss auf unser Handeln. Sie dienen als Motivationskraft und stiften in kollektiv geteilter Form Beziehung und Nähe zu anderen Menschen oder dienen der Abgrenzung von feindlichen Gruppen. Gefühle haben die Aufgabe, zu erkennen, was auf uns einwirkt, auszudrücken, was wir empfinden, und zu bewerten, was wir erkannt haben.
In der Politik und in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen spielen Gefühle deshalb eine zentrale Rolle: Der affektive Furor, den der Populismus entfacht, bündelt ohnmächtige Wut, blinden Hass, Neid, Verbitterung und Rachewünsche zu Ressentiments, die das soziale Zusammenleben vergiften. Gefühle, die an der menschlichen Verletzbarkeit anknüpfen, wie etwa Besorgnis, Trauer, Mitleid, Empathie und Hoffnung, eröffnen hingegen die Chance auf alternative Perspektiven. An zahlreichen Beispielen aus aktuellen politischen Auseinandersetzungen erläutert der Autor, wie Gefühle politisches Handeln beeinflussen und wie mit Gefühlen Politik gemacht wird.
Wenn ich mich in diesem Buch vorwiegend– wenn auch nicht ausschließlich– mit negativen Gefühlen beschäftige, gilt es zuvor, ein mögliches Missverständnis ausräumen: Negative bzw. averse Gefühle sind nicht per se schlecht oder böse, genauso wenig wie positive Gefühle an sich immer gut sind. Der Mensch ist aufgrund seiner extremen Abhängigkeit von der Nähe, Anerkennung, Liebe und Zuwendung anderer Menschen, die besonders in den ersten Phasen seines Lebens ins Auge fällt, aber im Grunde das ganze Leben lang andauert, auf positive Gefühle zu anderen Menschen existenziell angewiesen. Positive Gefühle wie Liebe, Mitgefühl, Achtung und Anerkennung dienen der Aufrechterhaltung und Regulierung von Kontakt, Nähe und Kommunikation sowie dem Selbstwertgefühl und der Identität. Averse Gefühle dienen hingegen der Abgrenzung gegen Übergriffigkeit, Vereinnahmung, Dominanz und Instrumentalisierung. Sie beziehen sich also eher auf konfliktträchtige oder gefährliche Situationen. Zur Wahrung unserer Außengrenzen, unserer Souveränität, unserer Unversehrtheit und unserer Identität sind sie aber enorm wichtig. Es gilt also, auch die negativen Gefühle– bei uns selbst und bei anderen– wahrzunehmen, ernstzunehmen, sie aber auch zu mentalisieren, zu regulieren und zu reflektieren und dann die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
In der philosophischen Diskussion über die Bedeutung von Gefühlen wurde seit Aristoteles immer wieder die Position vertreten, dass averse Gefühle wie beispielsweise Neid, Eifersucht, Hochmut, Geiz und Gier schädlich und ethisch verwerflich seien. Die christliche Tugendlehre hat sie gar zu Todsünden erklärt. Die Psychoanalyse kann eine wichtige Differenzierung zu dieser Diskussion beitragen: Sie unterscheidet zwischen »reinen Gefühlen« auf der einen und ihrer mentalisierenden inneren Bearbeitung und den darauffolgenden Handlungen auf der anderen Seite. Gefühle werden unwillkürlich von unserer Psyche generiert, ohne dass unser Wille und unser Bewusstsein darauf Einfluss hätten. Gefühle können und sollten keinen moralischen Kategorien unterworfen werden. Sie sind Signale, die etwas darüber aussagen, wie wir uns selbst und die anderen wahrnehmen. Insofern sollten sie nicht verdrängt, sondern ernstgenommen werden.
Anders verhält es sich mit den möglichen Auswirkungen, die unsere Gefühle auf unser Denken und Handeln haben. Unsere Handlungen und unser Denken unterliegen potentiell unserem Bewusstsein und unserer willkürlichen Kontrolle. Sie können und sollten deshalb auch ethischen Kriterien genügen. Ihre materielle Basis haben Gefühle in der Psyche des Individuums. Gefühle können aber mit anderen geteilt werden, sodass eine mehr oder weniger große Gruppe von Menschen in den gleichen Gefühlszustand gerät, sei es bei einem Fußballspiel, einem Konzert oder in einer sozialen Bewegung. Aber nicht nur bei außergewöhnlichen und aufregenden Situationen, sondern auch bei ganz alltäglichen sozialen Begegnungen stellen sich kollektiv geteilte Gefühle, Stimmungen oder Atmosphären ein, die man beispielsweise als angespannt, gelöst, heiter, bedrückt, ausgelassen, ängstlich usw. charakterisieren kann.
In der Philosophie und den Sozialwissenschaften finden solche kollektiv geteilten Gefühlszustände unter dem Stichwort »Atmosphären« zunehmend Beachtung (Böhme, 2013; Schmitz, 2014; Bude, 2016). In der Psychotherapie wird die gezielte Mentalisierung der Gefühle immer stärker als zentrales Agens des therapeutischen Prozesses betrachtet (Plassmann, 2019; Sulz, 2021). Da Gefühle dazu dienen, Beziehung und Nähe zu anderen Menschen herzustellen oder auch begrenzend zu regulieren, ist es nicht verwunderlich, dass Gefühle gleichsam ansteckend sind. Auch können »Gefühlserbschaften« transgenerational weitergegeben werden (Lohl& Moré, 2014).
Gefühle haben einen großen Einfluss auf unser Handeln. Sie dienen als Motivationskraft und stiften in kollektiv geteilter Form Beziehung und Nähe zu anderen Menschen oder dienen der Abgrenzung von feindlichen Gruppen. Gefühle haben die Aufgabe, zu erkennen, was auf uns einwirkt, auszudrücken, was wir empfinden, und zu bewerten, was wir erkannt haben. In der Politik und anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen spielen Gefühle deshalb eine zentrale Rolle: Der affektive Furor, den der Populismus entfacht, bündelt Gefühle von ohnmächtiger Wut, blindem Hass, Neid, Verbitterung und Rachewünschen zu Ressentiments, die das soziale Zusammenleben vergiften. Gefühle, die an der menschlichen Verletzbarkeit anknüpfen, wie etwa Besorgnis, Trauer, Mitleid, Empathie und Hoffnung, eröffnen hingegen die Chance auf alternative Perspektiven. In diesem Buch versuche ich am Beispiel aktueller politischer Auseinandersetzungen zu ergründen, wie Gefühle politisches Handeln beeinflussen, und wie mit Gefühlen Politik gemacht wird.

