ZUHAUSE IST DER ORT, DEN DU VERLASSEN HAST.
In seinem berühmten Essay „ Das Unheimliche“ (1919) prägte Sigmund Freud den Begriff des Zuhauses als ambivalenten Ort. Die Theorie basiert auf dem Paradoxon des deutschen Begriffs „unheimlich“, der Negation von „heimlich“: gemütlich, vertraut, heimelig, ein Ort, an dem man sich sicher und geborgen fühlt, aber gleichzeitig auch der Bereich der Geheimnisse, des Verborgenen, das man anderen nicht zeigen soll und das in uns ein unangenehmes Unbehagen auslöst. Das Zuhause, dem wir entwachsen sind, kann Angst und Schrecken hervorrufen, wenn wir uns ihm nähern. Laut Freud ist es die Rückkehr dessen, was einst vertraut war und nun verdrängt oder verdrängt wurde, die uns im Unheimlichen tatsächlich erschaudern lässt.

In seiner Neuinterpretation Freuds sieht Jacques Lacan das
Zuhause als etwas, das immer schon verloren ist (Objekt A) und in Wirklichkeit immer erst im Nachhinein konstruiert wird. Das heißt, das Subjekt war nie wirklich in dieser absoluten Version von Zuhause
und kann daher auch nie dorthin zurückkehren. Denn in Lacans
Theorie ist das Subjekt gespalten: Es hat seine Einheit nicht verloren, sondern seine Existenz wird erst durch diese Spaltung ermöglicht. Die Vorstellung eines Bruchs der Einheit mit der Umwelt ist somit ein Trugschluss. Was aber existiert, ist die Illusion des zerstörten Paradieses und eines einstigen Zustands der Nicht-Entfremdung, irgendwo in der Vergangenheit verortet. Auch Freud nahm eine solche tatsächliche, verlorene Einheit an: anthropologisch in der Vorgeschichte des „Urmenschen“ sowie auf individueller Ebene in der Zeit vor dem Ausbruch des Ödipuskomplexes..

Wenn Lacan behauptet, das Subjekt sei an sich gespalten, bedeutet dies, dass wir mit der Tatsache der Entfremdung leben und die Brüche und die radikale Andersartigkeit der Welt ertragen müssen. Wer diese Entfremdung akzeptiert, hat die symbolische Ordnung in
sein Leben integriert und kann als Erwachsener mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen. Das Symbolische schafft Strukturen und Grenzen; es spaltet, unterbricht, schafft Hierarchien und trianguliert. Demgegenüber gibt es in der dualen Bildsprache nur das Ich und sein Spiegelbild, in dem sich das Ich wiederherstellt. Hier sind Vollständigkeit und Identifikation möglich. Alles scheint Sinn zu ergeben.

In der psychoanalytischen Theorie wird die Wiederbegegnung mit
bereits überwundenen Entwicklungsstadien als Regression bezeichnet. Diese Regression kann zeitlicher Natur sein und beispielsweise vom Erwachsenen- in den Säuglingszustand führen; sie kann aber auch formaler verlaufen, von einer symbolischen zu einer imaginären Auseinandersetzung mit der Welt.

Wie die meisten Menschen, deren Eltern geschieden sind, wünsche ich mir, dass meine Eltern wieder zusammenkommen. Wenn sie dann Pflege benötigen, müsste ich nur noch ihre neuen Partner in Pflegeheime geben und könnte meine geschiedenen Eltern zu Hause pflegen und sie bis zu ihrem Tod wieder in ihr Ehebett zurückführen. Das ist für mich mein größtes Ideal vom Glück. [1]

Als Charlotte Roches Ich-Erzählerin Helen von ihrem lang gehegten Wunsch nach der Wiedervereinigung ihrer Eltern spricht, wird eine solche Regression deutlich. Helen äußert eine kindliche Sehnsucht nach Einheit und Vollständigkeit: nach einer idyllischen Welt. In diesem regressiven Traum wird der Widerstand der Realität (d. h. die Trennung ihrer Eltern) nicht akzeptiert, sondern verleugnet. Mit ihrem
Wunsch, die Trennung wieder aufzuheben, artikuliert Helen die Sehnsucht nach einem Zustand vor der Trennung. Die Verleugnung der Trennung der Eltern bedeutet die Verleugnung der symbolischen Ordnung (die stets Trennung und Grenzen mit sich bringt).

Die Generation, die Roche in seinem Buch beschreibt, ist die erste,
die schon als Kinder massiv von der hohen Scheidungsrate betroffen ist. Gleichzeitig scheint es, als wolle diese Generation – den in Filmen, Büchern, Werbung usw. zum Ausdruck kommenden kulturellen Fantasien nach zu urteilen – nicht der Gesellschaft entfliehen, sondern sich zurückziehen. Während Easy Rider 1969 von Freiheit und Exzessen erzählte und damit den Zeitgeist der 1960er-Jahre zu verkörpern schien, schildert Azazel Jacobs’ Film Momma’s Man (2008) heute den Rückfall eines jungen Vaters, der seine Eltern besucht und dessen Leben unerwartet in seinem Elternhaus stecken bleibt. Es gelingt ihm nicht, diese räumlichen und familiären Strukturen zu verlassen, um sein Erwachsenenleben fortzusetzen. Sein Besuch wird zur Sackgasse, denn die Rückkehr nach Hause bietet nicht nur Sicherheit und Schutz, sondern birgt auch Schmerz, Stagnation und Einengung.

Heutzutage scheinen kulturelle Freiheitsfantasien ( à la Easy Rider )
allmählich zu verschwinden, da die Freude am Ausbruch mit der Enge oder Unveränderlichkeit der zu sprengenden Strukturen zunimmt. Wird das Zuhause zerbrechlich, zerfällt auch der Ort, von dem man sich vehement abwenden kann .

Für die heutige Generation junger Erwachsener gehen die Trends zum Rückzug in die eigene vier Wände und zur Etablierung eines festen Zuhauses mit (privaten, sozialen und finanziellen)
Zukunftsängsten und Unsicherheiten einher. Heutzutage wollen wir
unsere Elternhäuser nicht mehr so sehr abreißen, sondern suchen eher nach einem passenden Grundriss. „Ich habe nie davon geträumt, auszubrechen“, bemerkte kürzlich ein Kollege von mir; „seit ich denken kann, habe ich immer davon geträumt, einzubrechen.“

Die fortwährende Suche nach einem Platz in der Gesellschaft (und
im Leben) erscheint mir ein typisches Phänomen meiner Generation zu sein. Es ist, als wüssten wir alle nicht mehr so recht, wohin wir uns wenden sollen. Eine gewisse Orientierungslosigkeit und
Rastlosigkeit führt bei vielen von uns oft dazu, dass wir ständig in unseren Lebenslauf investieren und auf vielfältige Weise versuchen, Zufluchtsorte zu finden, um unserem Leben, das wir als auf der Durchreise empfinden, Halt zu geben.

Die autobiografische Vergangenheit, das ehemalige Zuhause, kann ein solch verlockender Zufluchtsort sein. Ein Ort, an dem wir rückblickend vollständig und unversehrt erschienen , ein Ort, an dem wir unsere Rolle im System noch zu kennen und zu verstehen schienen .

Wenn ich mich meinem ehemaligen Zuhause zuwende, wird mir die Unvereinbarkeit meiner Lebensplanung mit meiner aktuellen Lebensphase deutlich. Ich kann und werde mein Leben nie so leben wie meine Eltern (bürgerliches Umfeld, Nachkriegsgeneration) oder so, wie ich es mir in meiner Kindheit und Jugend erträumt habe: so geborgen, so zu Hause. Denn meine Welt (Kunst, urbanes Umfeld,
die Unsicherheiten des Berufs, die Ungebundenheit des Ortes) erscheint mir flexibler, instabiler und fragmentierter als die Welt, von der man mir in meiner Kindheit erzählte. Vielleicht sind es diese Aspekte des Lebens (die ich mit vielen meiner Generation teile), die mich ständig auf der Suche nach meinem Platz in der Gesellschaft und der Welt antreiben.

Die Fotoserie „Home is the place you left “ [2] zeigt Experimente der Heimkehr. Der Titel verweist auf die retrospektive Projektion dieses Gefühls: „Zuhause sein“ und die Suche danach werden erst möglich, nachdem wir es verlassen oder verloren haben.
Die inszenierten (performativen) Fotografien zeigen die
experimentelle Wiedereingliederung in das Elternhaus. Gezeigt werden Techniken, die eine erneute Zugänglichkeit von Räumen ermöglichen: das Hineinschreiben in die Räume, das Verbergen, Verstecken, Zurückkehren, Festhalten, mimische Anpassung an oder Kampf mit diesem Raum. Der Körper wird von diesen Räumen unterschiedlich aufgenommen und zugleich provisorisch integriert oder abgestoßen.
Die experimentelle Verschmelzung scheitert zwangsläufig. Der Körper bleibt in diesen Räumen ein störender Überschuss.
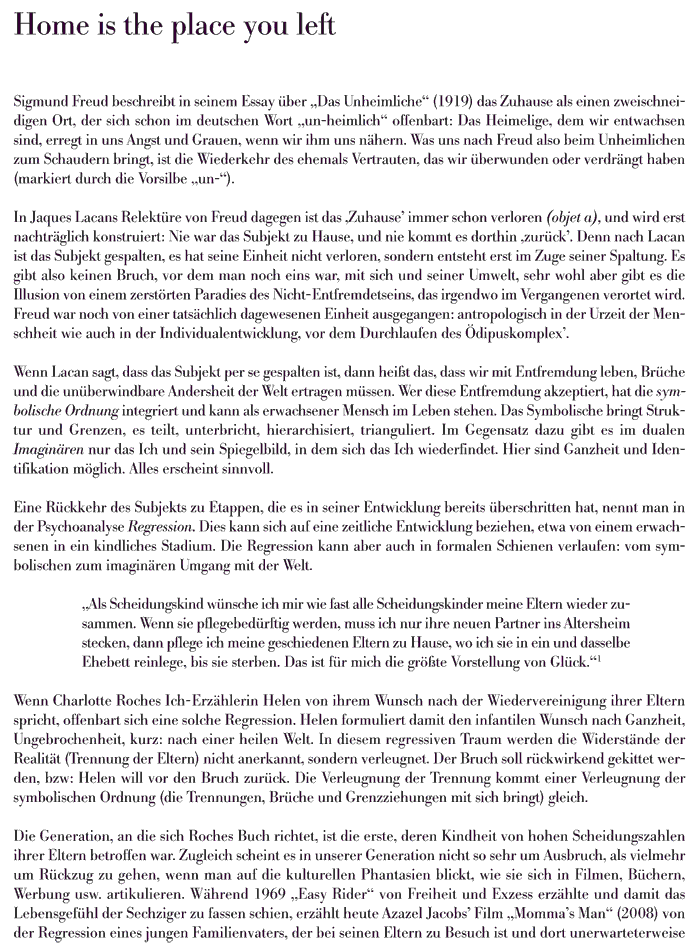
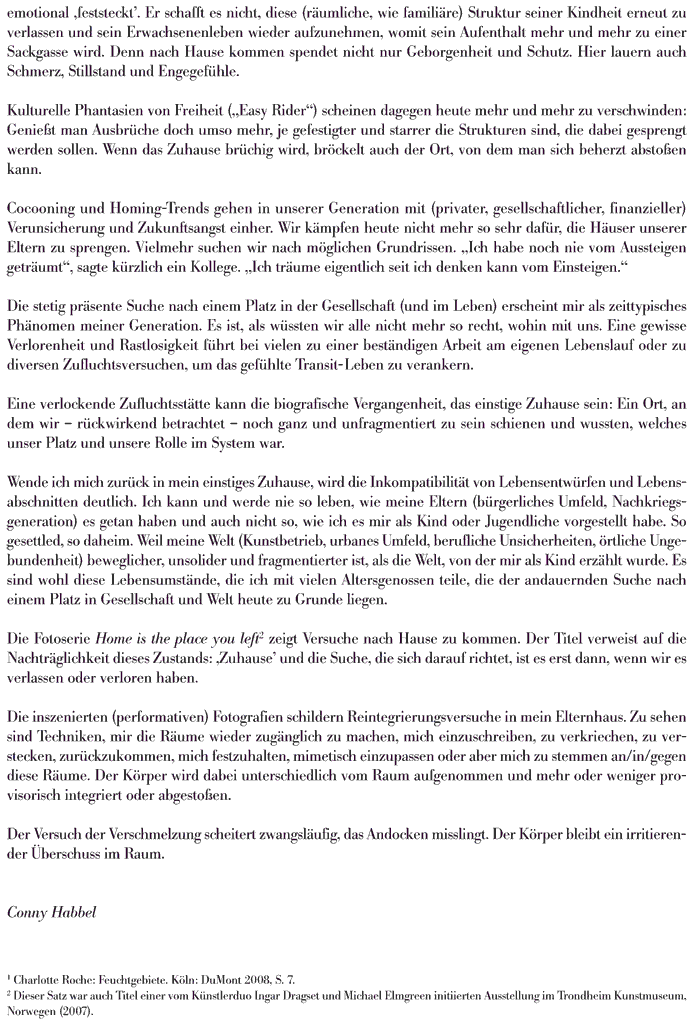
Rainer Maria Rilke – Du musst das Leben nicht verstehen
Du musst das Leben nicht verstehen,
dann wird es werden wie ein Fest.
Und lass dir jeden Tag geschehen
so wie ein Kind im Weitergehen
von jedem Wehen
sich viele Blüten schenken lässt.
Sie aufzusammeln und zu sparen,
das kommt dem Kind nicht in den Sinn.
Es löst sie leise aus den Haaren,
drin sie so gern gefangen waren,
und hält den lieben jungen Jahren
nach neuen seine Hände hin.

