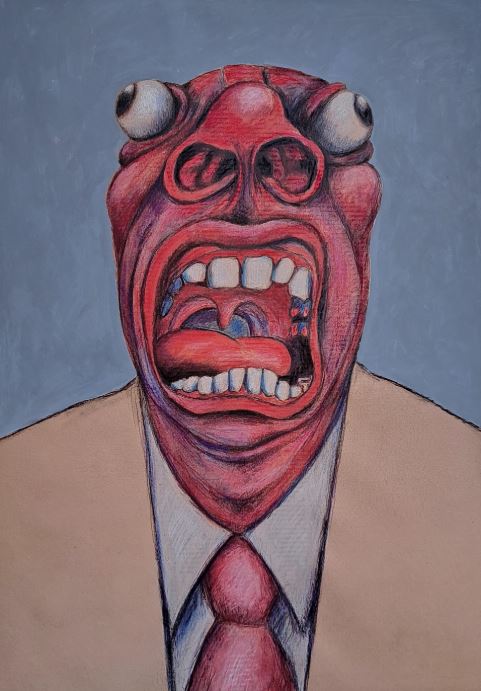„Die Grundfrage lautet: Ist Aggression ein Trieb, d. h. eine sich aus einer somatisch verankerten Reizquelle speisende und ständig
fließende Kraft, die nach Abfuhr und Entladung drängt; oder ist sie eine angeborene Affekt- und Handlungsdisposition, die dann
ausgelöst und eingesetzt wird, wenn das Subjekt sich bedroht, gekränkt, beleidigt etc. fühlt, d. h. als Reaktion auf Frustrationen im
weitesten Sinn“ (Dornes, 2009, S. 244).
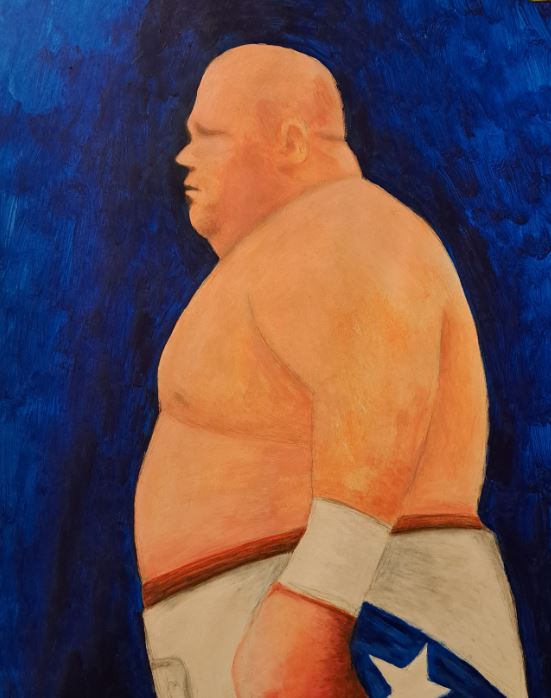
Komm nur her wenn du dich traust! Hier gibts kloppes!
Lange Zeit wehrte Freud sich dagegen, einen eigenständigen Aggressionstrieb zuzulassen. Das Problem der Aggression löste er, indem er den Primärtrieben aggressive Tendenzen zusprach
(Freud, 1909b, S. 371). Inwieweit sein Widerstand auf die Trennung von Alfred Adler zurückzuführen ist, sei dahingestellt. Tatsache
ist, dass Adler mit der Einführung seines Aggressionstriebes 1908 der Libido ihre tragende Rolle raubte und sie somit entmachtete (Adler, 1908b). Dies lag sicher nicht im Sinn Freuds.
Tatsache ist aber auch, dass es nicht einfach ist, einen Aggressionstrieb entsprechend der Libido zu entwerfen, weil es strukturelle Probleme mit sich bringt, auf die hier jetzt nicht
näher eingegangen werden soll (Müller-Pozzi, 2008, S. 157 ff.).
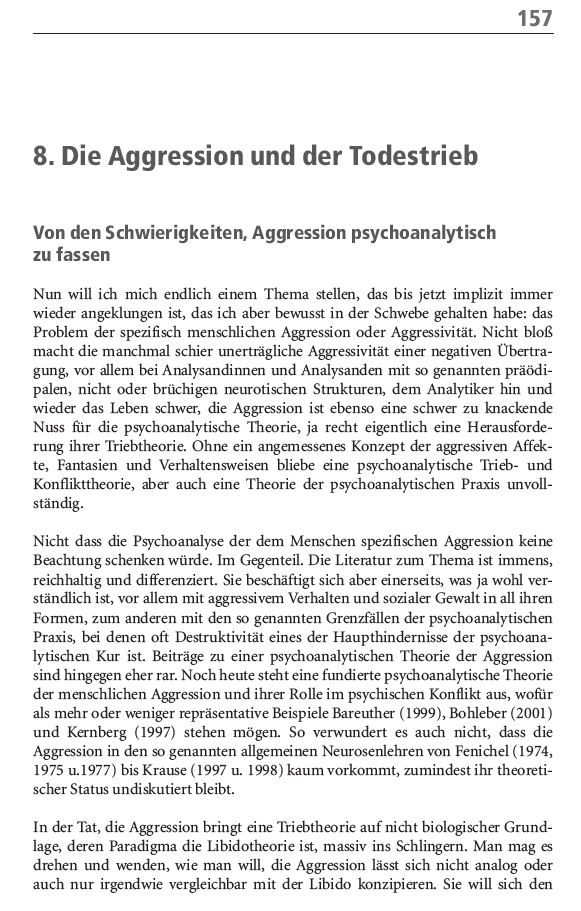
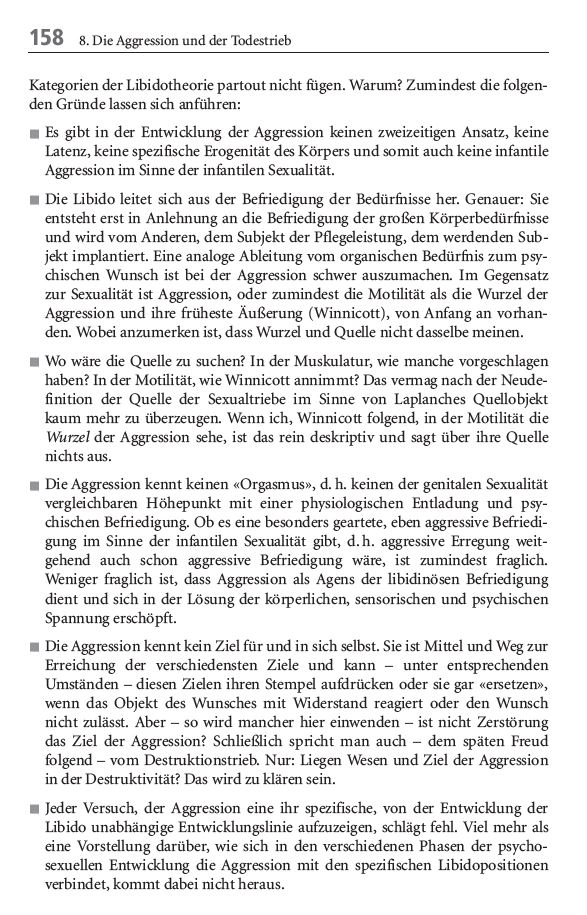
1920 revidiert Freud in „Jenseits des Lustprinzips“ den ersten Dualismus, indem er nun Lebens- und Todestrieb gegenüberstellt (Eros und Thanatos). Während er Sexualität als Äußerung des Lebenstriebes definiert, legt er Aggression als Ausdruck des
Todestriebes fest (Freud, 1920g). Darauf aufbauend formuliert er schließlich 1923 doch einen Aggressionstrieb (Freud, 1923a, 1923b).

Eros und Thanatos
Betrachtet man die Neugier und das Interesse von Säuglingen im Zusammenhang mit Freuds Postulat eines angeborenen Aggressionstriebes, der spontan-endogen von einer primären
Destruktivität hergeleitet wird, so gerät man in einen Erklärungsnotstand. Denn: Da Neugeborene noch nicht über ein Ich verfügen, das eine Sublimierung oder Neutralisierung leisten könnte, kann ihre Exploration auch nicht als Umkehrung der Libido gedeutet werden. Gleichzeitig ist sie ebenso wenig als Ausdruck des Aggressionstriebes zu verstehen, da ihr der destruktive Charakter fehlt (Dornes, 2009, S. 247). Aufgrund dieses Problems der
Triebtheorie haben einige ForscherInnen den Aggressionstrieb in ihrer Sichtweise um eine konstruktive Komponente erweitert, welche
somit Regungen wie Neugier, Exploration, Bewegung etc. im Sinn einer Aggression als Antrieb erklärbar macht: Winnicott (1950),
Spitz (1974), Parens (1979) u. a. Außer Parens haben allerdings alle genannten Wissenschaftler weiterhin am Konstrukt einer primären
Destruktivität festgehalten (vergleiche dazu die Ausführungen von Martin Dornes (2009).
Müller-Pozzi betont, dass sich die Libido – das Lust- und Lebensprinzip – ohne die Bindung des Aggressionstriebes in eine psychische Struktur gar nicht ausbilden kann. Damit spricht er die Triebmischung (Freud, 1920g) in dem Sinn an, als dass eine Integration der Aggression in die Libido nötig ist, um sich die Welt zu eigen machen, sich ihrer bemächtigen zu können:
„Unversehens erhält der Dualismus der ersten Triebtheorie Freuds ihre volle psychoanalytische Relevanz, wenn wir bloß an die Stelle des Selbsterhaltungstriebes die Aggression setzen, die in der frühzeitigen Geburt des Menschen freigesetzt wird und des Bemutterns, der spezifischen Aktion des Nebenmenschen, des
Anderen, bedarf, sie zu binden“ (Müller-Pozzi, 2008, S. 165).
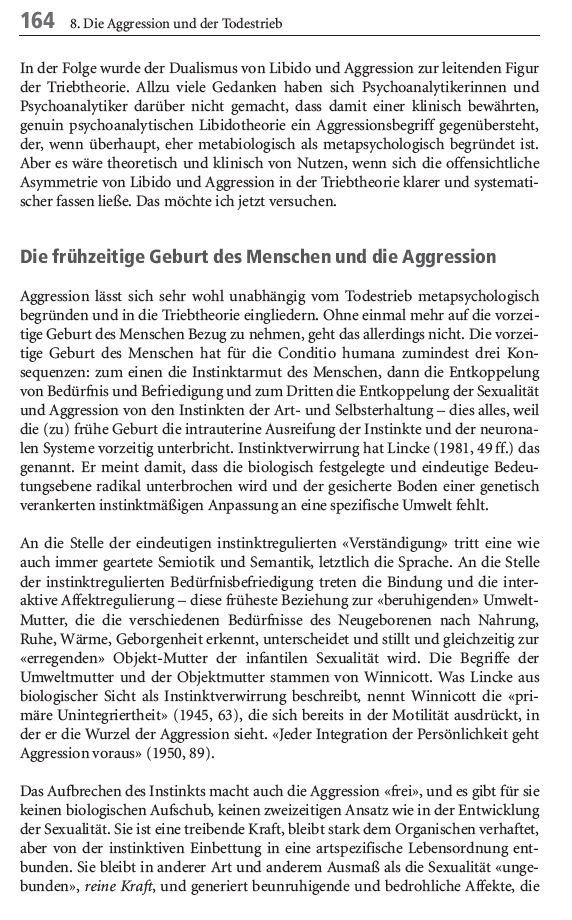
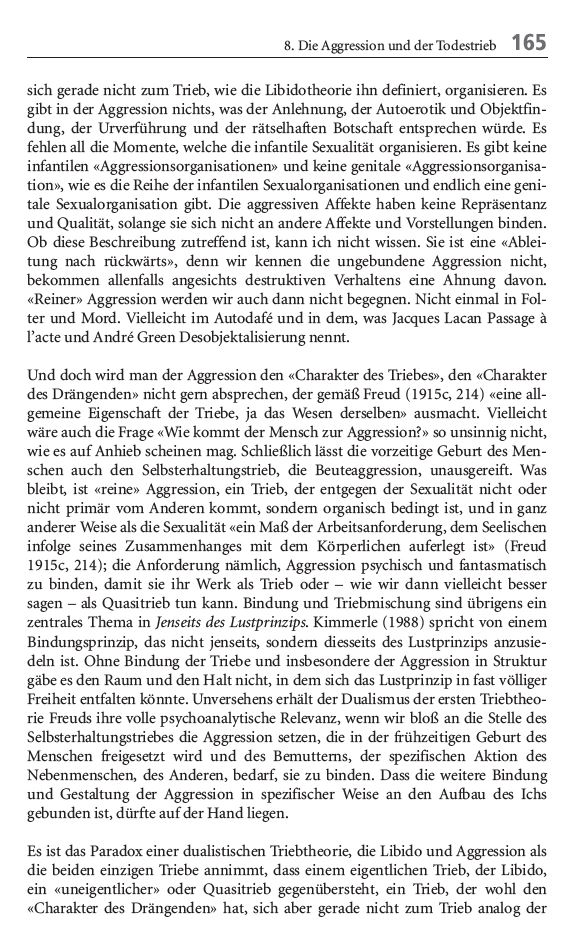
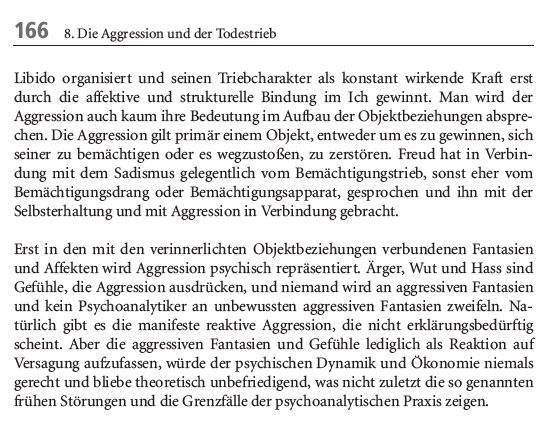
Der psychoanalytische Begriff „Bindung“ ist nicht mit Bowlbys Bindungsbegriff zu verwechseln und meint die Bindung von Erregung zur Bildung psychischer Struktur, obgleich das
Zitat implizit deutlich macht, dass die Qualität der Bindung in Bowlbys Sinn maßgeblich Einfluss darauf hat.
In Anlehnung an Freud geht Müller-Pozzi davon aus, dass der Mensch die nachgeburtliche Reizüberflutung mit einem „primären Hass“ als Unlustreaktion im Dienst der Selbsterhaltung beantwortet. Dieser muss in der Folge mithilfe der Objektbeziehung gebunden werden und sei somit älter als die Liebe (ebd., S. 177 ff.). Es gibt allerdings nichts, was die Annahme dieses primären Hasses nahelegen würde. Vielmehr ist inzwischen das Gewicht der – positiven wie negativen – vorgeburtlichen Beziehungserfahrungen bekannt. Die Liebe, gleichermaßen wie die Ablehnung (in dieser Phase vor allem) der Mutter, oder realistischerweise ihre „Affektmischung“, sind demnach schon intrauterin für die psychische und physische Entwicklung des Fötus relevant (vgl. Hüther & Krens, 2007).
Dementsprechend ist das, was Müller-Pozzi auf metapsychologischer Ebene beschreibt, um den Aggressionstrieb umzuformulieren,
zentral von der Beziehungsebene abhängig. Das bestätigt er u. a., wenn er konstatiert: „Eine präambivalente oder nicht ambivalente
Liebe gibt es nicht. Es gehört zum Wesen der Liebe, Ambivalenz, d. h. die libidinöse und aggressive Besetzung ein und derselben Objektimago, ertragen und fruchtbar machen zu können“ (Müller-Pozzi, 2008, S. 177). Dem ist beizupflichten. Aber: Müller-Pozzi entledigt sich der Energiequalität des Triebes und rückt an ihre Stelle die affektive Besetzung. Gleichzeitig nimmt er dem Trieb seine biologische Substanz und leitet seine Ausformung intersubjektiv her. In diesem Arrangement ist die Entstehung des Triebes an ein Gegenüber, an das Objekt, gekoppelt (ebd., S. 22–23). Damit richtet Müller-Pozzi seinen Blick weg von einem Aggressionstrieb hin zu einem Beziehungsgeschehen, das ohne Aggression nicht auskommt, allerdings ohne dass er dabei auf den Trieb verzichten würde. Es drängt sich die Frage auf, was dann überhaupt noch als Trieb festgemacht werden kann.