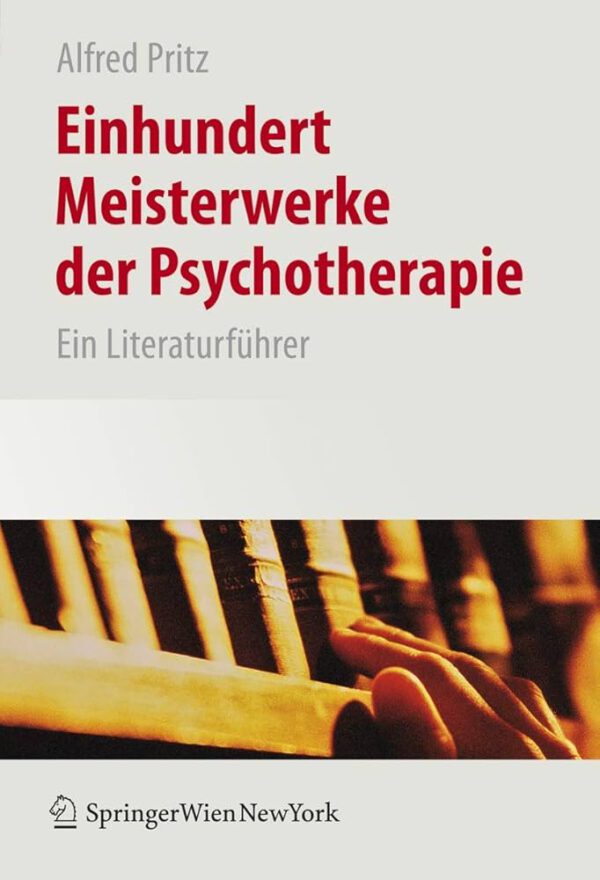Alfred Adler: Der Sinn des Lebens
Alfred Adler: Über den nervösen Charakter
August Aichhorn: Verwahrloste Jugend
Hermann Argelander: Das Erstinterview in der Psychotherapie
Virginia M. Axline: Dibs
Michael Balint: Therapeutische Aspekte der Regression
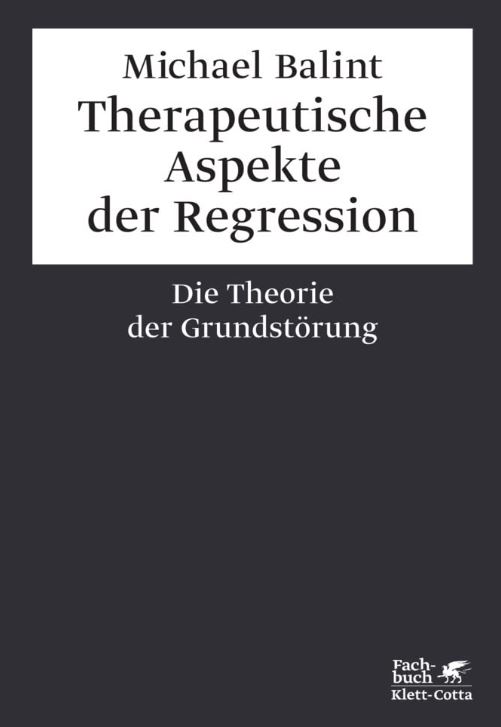
Balint geht von der Frage aus, warum selbst erfahrene und zuverlässige Analytiker gelegentlich mit Patienten zu tun haben, denen sie ratlos bis unsicher gegenüberstehen, und warum deren Therapien mitunter scheitern. Seine Antwort lautet, dass die klassische analytische Technik zwar für Patienten geeignet ist, welche die Deutungen des Analytikers als Deutungen erleben und deren Ich-Struktur in hinreichender Weise gefestigt ist, um die Deutungen in sich aufzunehmen. Andere Patienten sind dazu jedoch nicht fähig, und genau sie bereiten dem Analytiker oft Probleme. Um diese genauer zu skizzieren, unterscheidet Balint zwei Ebenen der analytischen Arbeit, die ödipale Ebene und die Ebene der Grundstörung. Die ödipale Ebene ist 1.) charakterisiert durch eine Dreierbeziehung, bei der außer dem Subjekt zumindest zwei Objekte beteiligt sind. Das können, wie in der ödipalen Situation, zwei Personen sein oder, wie im Zusammenhang mit der Oral- und Analerotik, eine Person und ein Gegenstand. 2.) ist dieser Bereich immer mit Konflikten verbunden, die aus der Ambivalenz herrühren, welche auf der Beziehung des Individuums zu seinen beiden Objekten beruht. Und 3.) kann die konventionelle Sprache der Erwachsenen als angemessenes und tragfähiges Verständigungsmittel verwendet werden. Demgegenüber ist die Ebene der Grundstörung 1.) dadurch charakterisiert, dass alle Vorgänge, die sich auf ihr abspielen, Teil einer Zweierbeziehung sind, welche sich von den herkömmlichen Beziehungen auf der ödipalen Ebene grundlegend unterscheidet. 2.) ist die Dynamik auf dieser Ebene nicht durch Konflikte gekennzeichnet, und 3.) ist dabei die Sprache der Erwachsenen oftmals unbrauchbar und irreführend.
Gregory Bateson: Ökologie des Geistes
Judith S. Beck: Praxis der Kognitiven Therapie
Aaron T. Beck, A. John Rush, Brian F. Shaw, Gary Emery: Cognitive therapy of depression
Gaetano Benedetti: Todeslandschaften der Seele
Eric Berne: Spiele der Erwachsenen
Siegfried Bernfeld: Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung
John Bowlby: Frühe Bindung und kindliche Entwicklung
Oliver Brachfeld: Minderwertigkeitsgefühle beim Einzelnen und in der Gemeinschaft
Michael B. Buchholz: Psychotherapie als Profession
Marie Cardinal: Schattenmund
Luc Ciompi: Affektlogik
Johannes Cremerius: Die Verwirrungen des Zöglings T.
Psychoanalytische Lehrjahre neben der Couch In: Johannes Cremerius: Vom Handwerk des Psychoanalytikers Das Werkzeug der psychoanalytischen Technik. Band 1 2. Auflage. Stuttgart: Frommann-Holzboog 1990 Erstausgabe: 1984
Cremerius erläutert in diesem Kapitel dieses Werkes neben den „Verwirrungen des Zöglings T.“ auch jene Aspekte, welche einem Analytiker — vor allem zu Beginn seiner Praxisjahre — zu mehr oder weniger schwierigen Problemen werden können. So schreibt er über das Schweigen auf der einen Seite und das „zu viel“ an Sprechen auf der anderen Seite, den Umgang mit Patienten, denen es schwerfällt, frei zu assoziieren, sowie die Phänomene der übertragung und Gegenübertragung. Nach diesen Themen und einem geschichtlichen Abriss erläutert Cremerius die Herangehensweise eines jungen Analytikers — den Zögling, wie er von Musil schon vorher bezeichnet wird — an all dieses Theoretische, das im Rahmen der Ausbildung an ihn herangetragen wird, oder treffender gesagt auf ihn niederprasselt. Das Kapitel ist in der dritten Person verfasst, wirkt aber fast so, als wäre es in Tagebuchform geschrieben.
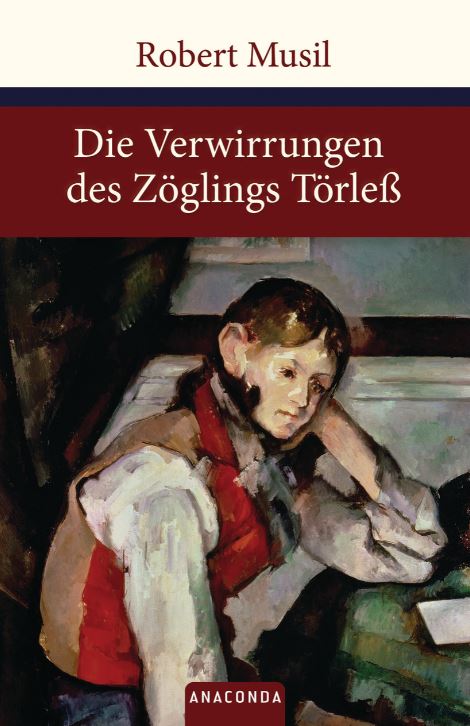
Johannes Cremerius: Vom Handwerk des Psychoanalytikers
Steve De Shazer: Das Spiel mit Unterschieden
Georges Devereux: Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften
Martin Dornes: Die emotionale Welt des Kindes
Dörte von Drigalski: Blumen auf Granit
Henry F. Ellenberger: Die Entdeckung des Unbewußten
Mario Erdheim: Die gesellschaftliche Produktion von Unbewußtheit
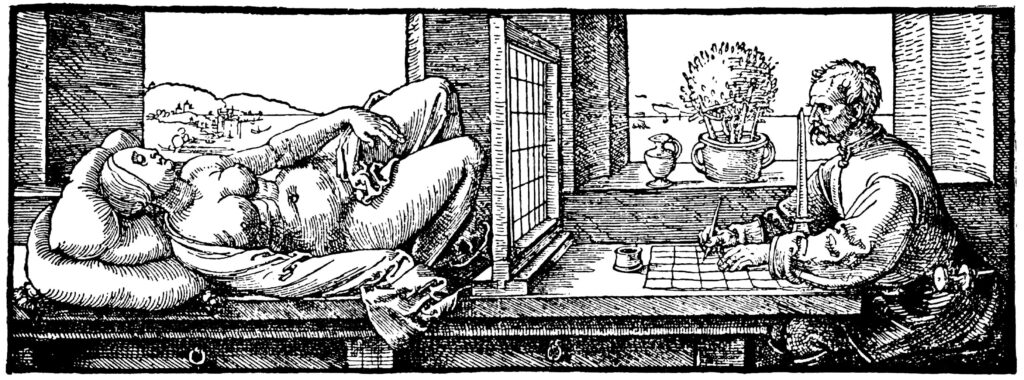
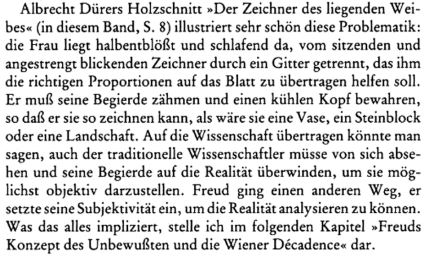
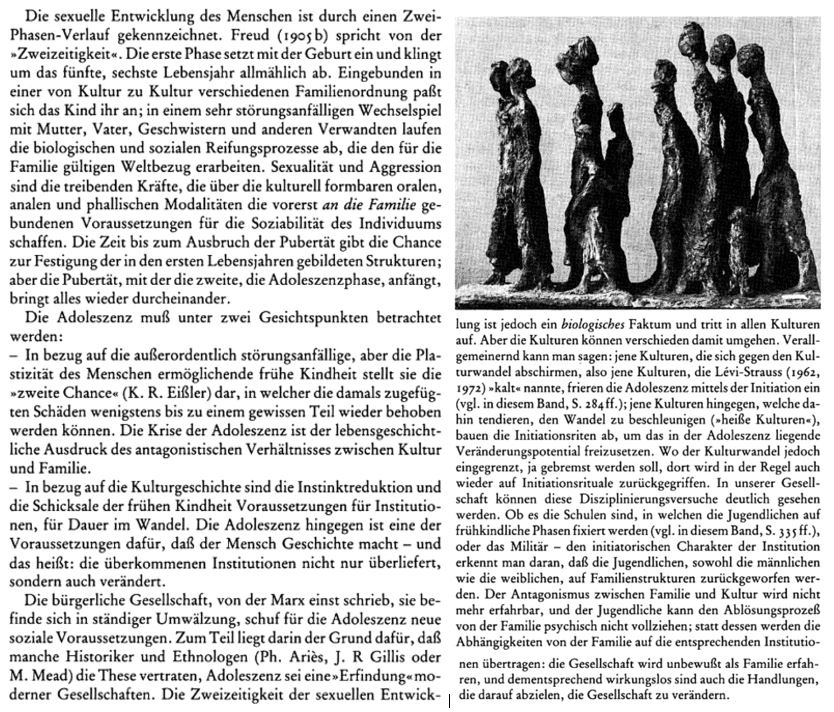
Erik H. Erikson: Identität und Lebenszyklus
Michel Foucault: Wahnsinn und Gesellschaft
Jerome D. Frank: Die Heiler
Viktor Frankl: … trotzdem ja zum Leben sagen
Anna Freud: Das Ich und die Abwehrmechanismen
Sigmund Freud:
Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur
Sigmund Freud: Zur Psychopathologie des Alltagslebens
Ben Furman: Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben
Peter Gay: Sigmund Freud
Klaus Grawe / Ruth Donati / Friederike Bernauer: Psychotherapie im Wandel
Ralph R. Greenson: Technik und Praxis der Psychoanalyse
Georg Groddeck: Das Buch vom ES
Georg Groddeck: Krankheit als Symbol
Iris Hanika / Edith Seifert: Die Wette auf das Unbewußte
Thomas A. Harris: Ich bin o. k. – Du bist o. k.
Lucien Israël: Die unerhörte Botschaft der Hysterie
Russell Jacoby: Soziale Amnesie
Eva Jaeggi: Und wer therapiert die Therapeuten?
C. G. Jung: Praxis der Psychotherapie
Frederick H. Kanfer / Hans Reinecker / Dieter Schmelzer: Selbstmanagement-Therapie
Karen Kaplan-Solms / Mark Solms: Neuro-Psychoanalyse
Verena Kast: Die Dynamik der Symbole
Otto F. Kernberg: Borderline-Störungen und pathologischer Narzißmus
Otto F. Kernberg / Birger Dulz / Jochen Eckert (Hrsg.): Wir: Psychotherapeuten über sich und ihren „unmöglichen“ Beruf
M. Masud R. Khan: Entfremdung bei Perversionen
Melanie Klein / Joan Riviere: Seelische Urkonflikte
Heinz Kohut: Die Heilung des Selbst
Sheldon B. Kopp: Triffst du Buddha unterwegs
Ronald D. Laing: Das geteilte Selbst
Michael J. Lambert (Ed.): Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and behavior change
Darian Leader: Why do women write more letters than they post?
Alfred Lorenzer: Intimität und soziales Leid
Michael J. Mahoney: Human change processes
Donald W. Meichenbaum: Kognitive Verhaltensmodifikation
Stavros Mentzos: Neurotische Konfliktverarbeitung
Franz Anton Mesmer: Abhandlung über die Entdeckung des thierischen Magnetismus
Alice Miller: Das Drama des begabten Kindes
Alexander Mitscherlich / Margarete Mitscherlich: Die Unfähigkeit zu trauern
Michael Lukas Moeller: Die Liebe ist das Kind der Freiheit
Hans Morschitzky: Psychotherapie Ratgeber
Tilmann Moser: Lehrjahre auf der Couch
Maria Selvini Palazzoli / Luigi Boscolo / Gianfranco Cechin / Giuliana Prata: Paradoxon und Gegenparadoxon
Paul Parin / Fritz Morgenthaler / Goldy Parin-Matthèy: Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst
Paul Parin / Fritz Morgenthaler / Goldy Parin-Matthèy: Die Weißen denken zuviel
Frederick S. Perls: Das Ich, der Hunger und die Aggression
Nossrat Peseschkian: Psychosomatik und Positive Psychotherapie
Hilarion Petzold (Hrsg.): Psychotherapie & Babyforschung Band 2: Die Kraft liebevoller Blicke
Hartmut Radebold: Die dunklen Schatten unserer Vergangenheit
Otto Rank: Das Trauma der Geburt und seine Bedeutung für die Psychoanalyse
Wilhelm Reich: Charakteranalyse
Wilhelm Reich: Die Funktion des Orgasmus
Johannes Reichmayr: Ethnopsychoanalyse
Arnold Retzer: Systemische Paartherapie
Fritz Riemann: Grundformen der Angst
Erwin Ringel: Selbstschädigung durch Neurose
Carl R. Rogers: Entwicklung der Persönlichkeit
Christa Rohde-Dachser: Expedition in den dunklen Kontinent
Johannes Heinrich Schultz: Das autogene Training
Daniel Stern: Die Lebenserfahrung des Säuglings
Berthold Stokvis / Eckart Wiesenhütter: Lehrbuch der Entspannung
Gerhard Stumm / Alfred Pritz / Paul Gumhalter / Nora Nemeskeri / Martin Voracek (Hrsg.): Personenlexikon der Psychotherapie
Gerhard Stumm / Alfred Pritz (Hrsg.): Wörterbuch der Psychotherapie
Helmut Thomä / Horst Kächele: Psychoanalytische Therapie
Thure von Uexküll / Rolf H. Adler / Jörg Michael Herrmann / Karl Köhle / Wolf Langewitz / Othmar W. Schonecke / Wolfgang Wesiack (Hrsg.): Psychosomatische Medizin
Vamik Volkan: Das Versagen der Diplomatie
Paul Watzlawick: Anleitung zum Unglücklichsein
Paul Watzlawick: Wie wirklich ist die Wirklichkeit?
Jürg Willi: Die Zweierbeziehung
Donald W. Winnicott: Vom Spiel zur Kreativität
Irvin D. Yalom: Theorie und Praxis der Gruppenpsychotherapie
Irvin D. Yalom: Existenzielle Psychotherapie
Irvin D. Yalom: Die rote Couch
Jeffrey E. Young / Janet S. Klosko / Marjorie E. Weishaar: Schematherapie
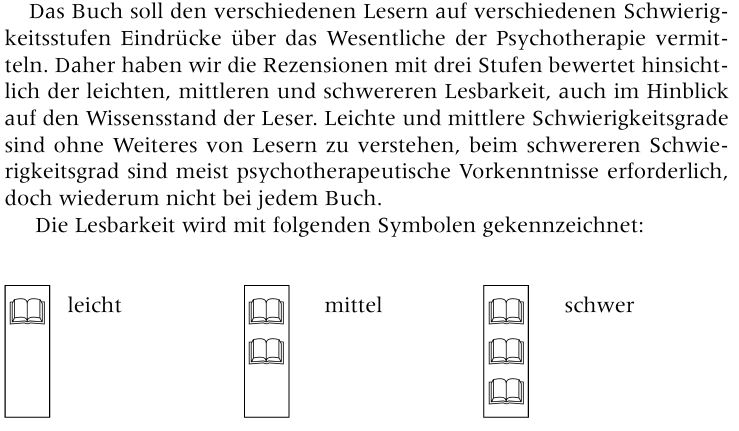
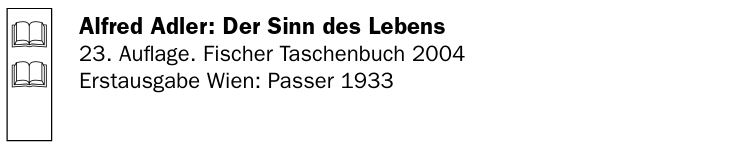
Die Meinung des Individuums vom Sinn des Lebens ist in letzter Linie die Richtschnur für sein Denken, Fühlen und Handeln. Der wahre Sinn des Lebens aber zeigt sich in dem Widerstand, der sich dem unrichtig handelnden Individuum entgegensetzt“ (S. 39). Welche Meinung jeder Mensch vom Leben hat, findet Ausdruck in dessen individuellem Lebensstil. Dieser wurzelt in den drei grundlegenden Adler’schen Mechanismen (dem Minderwertigkeitsgefühl, Streben nach Macht bzw. deren Überwindung und dem Gemeinschaftsgefühl) und der Rückmeldung der Umgebung. Jede Person empfinde sich innerhalb bestimmter Grenzen als minderwertig (Minderwertigkeitskomplex), ist aber gleichzeitig bemüht, dieses Minderwertigkeitsgefühl zu überwinden. Wie stark das Minderwertigkeitsgefühl ausgeprägt ist und die Art und Weise der Überwindung wird nach Adler schon in frühester Kindheit geprägt. Die Überwindung dieses Gefühls von Minderwertigkeit ist dem Menschen nur in der Gemeinschaft mit anderen möglich. Daraus folgt, dass der gesunde Mensch vor allem ein soziales Wesen darstellt, welches stets im Interesse der Gemeinschaft handelt (vgl. Freuds „Das Unbehagen in der Kultur“). Wie kommt es nun zu mehr oder weniger gemeinschaftsfreundlichen oder -feindlichen Lebensstilen? Ausschlaggebend sind im Wesentlichen vier gemeinschaftshindernde Kindheitssituationen:
- Mängel und Schwächen der organischen Ausstattung (sogenannte Organminderwertigkeit)
- Vernachlässigung und mangelnde Zuwendung
- Autoritärer Zwang und brutale Unterwerfung
- Verwöhnung oder Verzärtelung
In diesem Buch werden die Wirkung und die Mängel des gegenwärtigen Gemeinschaftsgefühls beschrieben, es werden die Menschenkenntnis und Charakterologie thematisiert und es wird versucht, die Bewegungsgesetze des Einzelnen und der Masse sowie deren Verfehlungen zu beschreiben. Adler war bestrebt, seine Anschauungen und Beobachtungen in einen streng wissenschaftlichen Zusammenhang zu bringen, was ihm auch gelungen ist: Eine immense Zahl von unmittelbaren Erfahrungen, ein System, welches diesen Erfahrungen Rechnung trägt und ihnen nicht widerspricht, konnte er aufstellen: die Individualpsychologie. Ein Werk, welches gut verstehen lässt, welche Fehler und Wünsche die Menschen haben, und die heutige Erziehung kritisch beleuchtet. „Der Sinn des Lebens“ ist ein spannender Führer durch die Individualpsychologie, der mit viel Lust und fundierten Theorien die Grundthemen dieser tiefenpsychologischen Richtung behandelt und der geeignet ist, sich einen Überblick über und einen Einblick in die Theoreme Adlers und der Individualpsychologie zu verschaffen. Er beschreibt den Sinn und Zweck menschlichen Lebens aus individualpsychologischer Sicht und zeigt die Folgen „falscher Erziehung“ auf, und das, ohne es nötig zu haben, sich hinter einer Mauer von sprachlichen Verklausulierungen zu verschanzen. Lesenswert für Fachleute sowie für Mütter, Väter, erziehende Personen und gesellschaftskritisch interessierte Menschen. Würden alle Pädagogen Adler gelesen haben, wäre die Welt wieder ein Stück besser. Ein wunderbarer Wegweiser und ein Vorbild, dass Tiefenpsychologie verständlich und nachvollziehbar, aber zugleich anspruchsvoll sein kann. Für mich stellt dieses Werk eine der gehaltvollsten Schriften der Tiefenpsychologie dar. Adler hat darin kurz vor seinem Tod alle wichtigen Erkenntnisse der von ihm begründeten Individualpsychologie zusammengefasst. „Die Individualpsychologie fordert weder die Unterdrückung berechtigter noch unberechtigter Wünsche. Aber sie lehrt, dass unberechtigte Wünsche als gegen das Gemeinschaftsgefühl verstoßend erkannt werden müssen und durch ein Plus an sozialem Interesse zum Verschwinden, nicht zur Unterdrückung gebracht werden können“ (A. Adler).

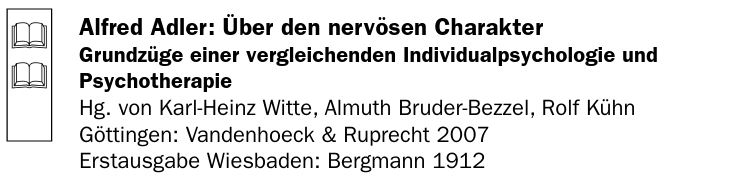
Der Titel des Buches wirkt vielleicht ein wenig irreführend, und das gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen wird im gegenwärtigen Sprachgebrauch jemand als nervös bezeichnet, der von Unruhe, Zerfahrenheit oder Unsicherheit erfüllt ist. Das ist nicht gemeint, „nervös“ bedeutet hier, im Einklang mit den sprachlichen Gepflogenheiten um 1900, neurotisch. Zum anderen sind mit „Charakter“ keine ererbten Eigenschaften gemeint; vielmehr entwickeln sich nach Adler dessen Grundlagen in der Kindheit und bilden ein Schema aus, das als Ergebnis einer zielgerichteten Einheit verstanden werden kann. Um die Entstehung und Entwicklung des „nervösen Charakters“ geht es im ersten Abschnitt, dem theoretischen Teil des Buches. Ein konstitutives Merkmal aller Kinder ist wegen ihrer Kleinheit und Unbeholfenheit ein Gefühl der Minderwertigkeit und Unsicherheit. Verläuft die Entwicklung in normalen Bahnen, so wird es durch ein Streben nach Anerkennung, Wertschätzung und Ebenbürtigkeit kompensiert, während das neurotische Kind danach trachtet, stets oben zu sein, andere hinter sich zu lassen oder sie zu überwältigen. Schwäche wird also im Falle einer normalen Entwicklung in Stärke und beim Neurotiker in vermeintliche Stärke verwandelt, denn Letztere bindet Ressourcen, welche zulasten der persönlichen und sozialen Entwicklung gehen. Allerdings sind die Grenzen zwischen psychischer Gesundheit und psychischer Krankheit fließend und insofern von relativem Charakter, zumal in beiden Fällen ein fiktives Endziel angestrebt wird. Die Vorstellungen, welche sich ein Kind macht, um in sicherere Bahnen zu gelangen, stimmen nämlich nur ungenau mit der Wirklichkeit überein. Sie treffen die Realität nie ganz, denn man nimmt diese nur selektiv wahr und projiziert eigene Wünsche auf die Vorbilder, denen man nacheifert. Erst recht gilt das für den neurotischen Menschen, der zu strikten antithetischen Wahrnehmungsschemata neigt und die Welt rigoros in ein Unten und ein Oben, in Stark und Schwach einteilt. Im zweiten Abschnitt des Buches, dem praktischen Teil, wird neurotisches Verhalten anhand von Fallbeispielen und weiteren theoretischen Einschüben exemplifiziert, wobei auch immer wieder Parallelen aus der Kulturgeschichte herangezogen werden, um das Gemeinte zu illustrieren. Im ersten Kapitel werden Geiz, Misstrauen, Neid und Grausamkeit thematisiert, in den Folgekapiteln unter anderem Phänomene wie Wahn (Kapitel II), Entwertungstendenz (Kapitel IV), Furcht vor dem Partner (Kapitel VIII) oder der „Familiensinn des Nervösen“ (Kapitel X). Im Sommer 1911 hatte sich Adler von Freud getrennt und den „Verein für freie psychoanalytische Forschung“ ins Leben gerufen, den späteren „Verein für Individualpsychologie“. Und bereits 1912 ist der „Nervöse Charakter“ erschienen, um der neuen Lehre ein eigenständiges Profil zu verleihen. Es handelt sich um das Hauptwerk der Individualpsychologie, wird aber bis heute unterschätzt. Es wurzelt in der Psychoanalyse und geht doch weit über sie hinaus. Mit Freud teilt Adler den immensen Einfluss der Kindheit auf das spätere Leben sowie die Bedeutung des Unbewussten als eines Spiels antagonistischer Kräfte, in dem Fall zwischen Minderwertigkeitsgefühl und Geltungsstreben. Während aber die Psychoanalyse im Einklang mit den Standards neuzeitlicher Kausalitätsvorstellungen primär auf die aristotelische Wirkursache Bezug nimmt, das heißt auf die Frage nach dem Woher, bezieht Adler auch die in der modernen Wissenschaftstradition marginalisierte aristotelische Zielursache mit ein, die Frage nach dem Wohin, indem er den Zielen und Zwecken menschlichen Verhaltens nachgeht, genauer – und das war ebenfalls neu – der Frage nach dem unbewussten Sinn. Verknüpft ist damit eine das analytische Denken erweiternde ganzheitliche Perspektive, indem der Charakter als zielgerichtete Einheit verstanden wird, die Adler später unter dem Begriff „Lebensstil“ fassen sollte. Die Erkenntnis, dass es sich dabei „um die Eintragung eines unwirklichen abstrakten Schemas in das wirkliche Leben handelt“ (23), betrachtet Adler als Hauptaufgabe seines Werkes, und genau das verleiht ihm auch heute noch Aktualität, denn dahinter steht eine frühe konstruktivistische Theorie, nämlich der Fiktionalismus des Neukantianers Hans Vaihinger. In seiner „Philosophie des Als Ob“, die erst 1911 im Druck erschienen ist, bemüht sich der Autor um den Nachweis, dass alle Annahmen und Theorien die sogenannte Realität nur in unzulänglicher Weise wiedergeben können. Um sich zu orientieren, müsse man aber „so tun, als ob“ sie wahr wären, und inwieweit sie der Wirklichkeit nahe oder fernstehen, könne nur die praktische Anwendung erweisen. Eine sinnvolle Fiktion sei beispielsweise die Einteilung der Erdoberfläche in Längen- und Breitengrade. Sie existierten nicht eigentlich, aber wenn man so tue, als wären sie vorhanden, könne man sich an ihnen orientieren. In Analogie dazu betrachtet Adler die Vorstellungen des Menschen über die Welt als Fiktionen, und der Unterschied zwischen der gesunden und der neurotischen Persönlichkeit besteht darin, dass jene nützlichere, da realitätsnähere Fiktionen verwendet als diese. Eine solche Sicht ist heuristisch wertvoll und lässt sich darüber hinaus mit der psychoanalytischen Theorie der Abwehrmechanismen verbinden, denn diese sagen implizit aus, dass man bestimmte Aspekte der Realität nicht wahrhaben will und so tut, als existierten sie nicht. Indirekt angesprochen ist damit auch die Frage nach dem Verhältnis von Rolle und Identität, womit nicht nur Bezüge zur soziologischen Rollentheorie existieren, sondern auch zu den kulturgeschichtlichen Konzepten der Bühnenmetapher (Theatrum Mundi) und des Homo ludens im Sinne Johan Huizingas.
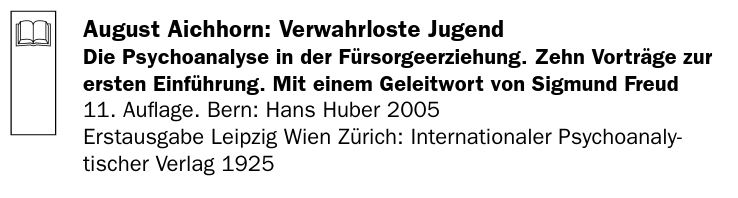
Die zehn Vorträge, die August Aichhorn ab 1924 im Ambulatorium der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung gehalten hat, sollen einem interessierten Publikum, das sich mit den Fragen der Fürsorgeerziehung auseinandersetzt, Anregungen und Hilfe bieten. Fürsorgeerziehung wird dann notwendig, wenn es nicht gelungen ist, einem Jugendlichen die seiner Altersstufe entsprechende Kulturfähigkeit zu vermitteln. Was bedeutet das? Durch Erziehung lernen die Menschen, sich unter Triebverzicht den Forderungen der Gesellschaft anzupassen. Hier weisen die verwahrlosten Jugendlichen ein Defizit auf. Wie Symptome zu analysieren sind und welche Ursachen zur Verwahrlosung führen, damit beschäftigt sich August Aichhorn in den ersten fünf Vorträgen. Die Symptome (Stehlen, Einbrechen, Schuleschwänzen usw.) werden ganz im Sinne der Psychoanalyse als Kompromissbildungen zwischen verdrängenden und verdrängten Tendenzen dargestellt. Dabei geht es bei den verwahrlosten Kindern und Jugendlichen nicht in erster Linie um die Entfernung der Symptome, die durch ein psychisches Kräftespiel bedingt sind, sondern um die Heilung der Erkrankung selbst. Letztlich müssen, sollen anstelle der alten Symptome nicht neue ausgebildet werden, die Ichstruktur neu geordnet werden. Für die Aufdeckung der Ursachen ist es wesentlich, die Gründe für das Tun zu verstehen und diese als Ergebnis eines psychischen Kräftespiels anzuerkennen. Moralische Bewertungen der Handlungen eines Verwahrlosten oder eine Parteinahme für Eltern und die Gesellschaft sind nach August Aichhorn nicht hilfreich. Mit dem Phänomen der Übertragung, der Beziehung des Verwahrlosten zum Erzieher, beschäftigt sich der sechste Vortrag. Die Art, wie sich das Liebesleben der Kindheit gestaltet, ist wesentlich. Das Liebesbedürfnis der später Verwahrlosten wurde entweder zu wenig befriedigt oder, so August Aichhorn, übersättigt. Beide Typen der Verwahrlosung erfordern ein unterschiedliches Handeln der Erzieher, bedeutsam ist jedoch das intuitive Erfassen der Situation. Mehrfach – und so auch hier – grenzt August Aichhorn Psychoanalyse von Erziehung ab. Im siebenten Vortrag beschreibt August Aichhorn die speziellen Bedingungen in den Fürsorgeerziehungsanstalten der Stadt Wien, Oberhollabrunn und Sankt Andrä an der Traisen, deren Leitung er innehatte. In Abgrenzung zu den Anstalten alten Stils, wo Gewalt ständig als Mittel der Beherrschung eingesetzt wird, werden hier die Gruppen der Jugendlichen nach Temperament und Führungsmöglichkeit gebildet. Wesentlich erscheint der Gedanke, dass die Gruppierung selbst in den Dienst der Heilung gestellt werden kann. Die auftretenden Konflikte sollen zur Erreichung der Erziehungsziele eingesetzt werden. Eine Entwicklung der Fähigkeit, die Triebregungen zu unterdrücken und die gesellschaftlichen Normen anzuerkennen, wird angestrebt. Voraussetzung ist hier die Schaffung eines besonderen Milieus, getragen von Zuneigung und Lebensbejahung. Die positive Einstellung des Erziehers zum Leben, in dessen Handlungen die Jugendlichen Zuneigung zu erkennen fähig sind, wird als wesentlich für die Herstellung einer positiven Übertragungsbeziehung erachtet. Im neunten und zehnten Vortrag erörtert August Aichhorn die Bedeutung des Lustprinzips und Ichideals für das soziale Handeln. Die Verwahrlosten werden in ihren Handlungen – bedingt durch Entwicklungsstörungen (Regression, Entwicklungshemmungen) – stark vom Lustprinzip beherrscht. Der Erzieher kann über die positive Übertragung den Jugendlichen neue Identifizierungsmöglichkeiten bieten und so eine Veränderung des Ichideals und der Charakterstrukturen einleiten. Damit ist Erziehung gleichzusetzen mit dem Nachholen individueller Entwicklung. Warum sollte man dieses Buch heute lesen? Darauf gibt es viele mögliche Antworten. Ich beginne mit dem Grundton, der sich durch diese Vorträge zieht: Er ist aufklärerisch im ursprünglichen Sinne des Wortes, möchte ein an der Thematik interessiertes Publikum zu einem anderen Verständnis für eine soziale Randgruppe bewegen. Die Sprache ist klar und verständlich, psychoanalytische Grundbegriffe werden anschaulich erklärt, Theorie und praktische Beispiele, die zahlreich vorhanden sind, miteinander verknüpft. Der Ton ist lebendig und der kommunikativen Situation des Vortrags angepasst, Einwände und Gedanken der ZuhörerInnen werden als Fragen vorweggenommen, Rekurse auf bereits Bekanntes und Wiederholungen verbinden die Inhalte der einzelnen Vorlesungen genauso wie eine Vorausschau auf Kommendes. Worauf man als Leser nicht trifft, sind fertige Rezepte, fixe Regeln im Umgang mit dem Verwahrlosten. Verallgemeinerungen und oberflächliche Schlussfolgerungen sind, so zeigt uns August Aichhorn, hinderlich. Und doch zieht sich ein Gedanke durch die Vorträge, nämlich das Bemühen um das Kind, die Parteinahme für dieses, der Versuch, hinter die Symptome zu blicken und ihm, dem Kind, geleitet vom psychoanalytischen Wissen, anders zu begegnen, als die Erziehungspersonen es üblicherweise taten und heute noch manchmal tun. Auch mehr als 80 Jahre nach dem Erscheinen des Buches erscheint August Aichhorns Einstellung zu den verwahrlosten Jugendlichen politisch und gesellschaftlich provokant. Welche Haltung sein Denken und Handeln prägt, veranschaulicht das folgende Zitat: „Es war uns von allem Anfange an gefühlsmäßig klar, dass wir Knaben und Mädchen und jungen Menschen im Alter von 14 bis 18 Jahren vor allem Freude zu bereiten hatten. Keinem von uns war je eingefallen, in ihnen Verwahrloste oder gar Verbrecher zu sehen, vor denen die Gesellschaft geschützt werden müsste … ich erinnere mich noch der Spannung, mit der wir den ersten Zögling erwarteten, und seines Behagens, als wir uns auf ihn stürzten, um ihn zu verwöhnen.“ In den Ausführungen von August Aichhorn trifft man immer wieder auf große Offenheit und Selbstkritik, es wird über Misserfolge und Verzweiflung bei Erzieherinnen genauso berichtet wie über Erfolge. Es ist ein auf die Reflexion des eigenen Tuns abzielendes Buch, das Mut auf psychoanalytische Pädagogik macht. In diesem Sinne ist es für LeserInnen geschaffen, die mit jungen Menschen in unterschiedlichsten Berufen zu tun haben. Ein Geleitwort von Sigmund Freud, in dem er die Leistungen August Aichhorns würdigt, ein Sachregister, eine Kurzbiographie Kurt Eisslers und ein Nachwort Heinrich Mengs und Thomas Aichhorns ergänzen die Ausgabe.
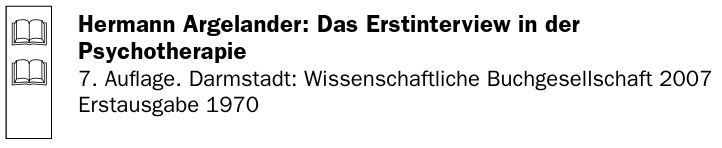
Das 112 Seiten umfassende Büchlein befasst sich in zwölf Hauptkapiteln mit der Erstellung eines modernen Konzepts des Erstinterviews in der Psychotherapie. Bereits in der Vorbemerkung geht der Autor auf die Erhebung und Verlässlichkeit der Daten ein, die sich aus drei Quellen speisen: die objektiven Informationen (biographische Anamnese), subjektive Informationen (Betonung der gemeinsamen Arbeit mit dem Patienten) und die szenischen oder situativen Informationen (unbewusste Beziehungsdynamik). Die Besonderheit der Ungewöhnlichen Gesprächssituation wird im gleichnamigen Kapitel deutlich. Aufgrund der Rahmenbedingungen als technisches Instrument bekommt der Aufbau und Ablauf des Gesprächs Struktur. Durch die Verwendung konkreter beispielhafter Auszüge aus Erstgesprächen gewinnt der Leser einen nahen Eindruck von der (Wechsel-)wirkung der Gesprächssituation. Sowohl der differenzierte sozialpsychologische Blick über mögliche Schwellenangst für das Aufsuchen eines Psychotherapeuten bei einigen Patienten als auch die Typologie der konsultierenden Personen gelingt in Die Gesprächspartner, ihre Motivation und Aufgaben. Der Autor gibt an, die Typisierung aus einer größeren Zahl von Interviewprotokollen unter der Einbeziehung von bewusster und unbewusster Therapiemotivation einerseits und der Krankheit andererseits gewonnen zu haben, um zu einer groben praktischen Orientierung zu verhelfen. Beim vorgeschickten oder vorgeschobenen Patienten handelt es sich um jene Personen, die nicht aus Eigeninitiative kommen; Argelander erläutert in diesem Zusammenhang das Vorliegen einer „Sozialen Krankheit“ und die Schwierigkeiten in der Behandlung. Der anspruchsvolle Patient ist jener, der bereits im Vorfeld zum Erstgespräch seine Forderungen oder Anliegen vorbringt, im Gegensatz zum (anspruchslosen oder) unergiebigen Patienten, der eine lähmende und abgeschlaffte Atmosphäre ausströmt. Den vierten und letzten Typus bezeichnet Argelander den aufgeklärten Patienten, den unter anderem sein differenzierter Intellekt und ein schwer zugängliches Gefühlsleben auszeichnen. Ferner wird auf die spezifische Interviewdynamik aller Typen bzw. Mischtypen und deren Widerstände eingegangen. Bei der Herstellung der Gesprächssituation werden die Fragen der Technik (des Vorfeldes) unter Miteinbeziehung institutioneller Gegebenheiten, Realitäten des Interviewers, Vorbereitungen der situativen Bedingungen und bestimmte Haltungen als technisches Prinzip erörtert. Schließlich wird die Psychopathologie des Patienten, seine Krankheit und ihre Bedeutung durch Vermittlung beispielhafter Herangehensweisen erläutert, die sich auf die Entwicklung und den Verlauf eines Erstgesprächs auswirken. Argelanders Psycho-Logik (als eine ungewöhnliche Form der Wahrnehmung und des Denkens) bringt eine Analyse der szenisch gestalteten Dynamik der Gesprächssituation, der Gestalt der Gesprächsinhalte und deren Auswirkung der Gesprächssituation im Sinne der phänomenologischen Intuition fertig, um in strukturierender Weise Unbewusstes aufzuspüren. Ferner gelingt es, auf reale Gegebenheiten und Indikationen unter Einbeziehung der Grenzsituation einzugehen. Das Therapeutische Interview (Fragen und Antworten zum Setting) definiert sich anders als Das Diagnostische Interview, welches sich in zwei Phasen bewegt: Hier kann einmal die Phase zur diagnostischen Erfassung, zur Indikationsstellung und Prognose (inklusive Probehandeln) und jene zur Einleitung der Behandlung genannt werden. Abrundend werden Probleme der Ausbildung und beispielhafte Lösungsansätze (zum Beispiel der Einsatz von Einwegspiegeln) für in Ausbildung zum Psychotherapeuten stehende Kollegen erörtert. Hermann Argelander (1920–2004) gelang es, ein modernes Konzept und Grundlagenwerk des Erstinterviews in der Psychotherapie zu erstellen, um jene individuelle Behandlungskunst zu strukturieren und zu veranschaulichen. Das Erstgespräch fungiert (neben einigen testpsychologischen Untersuchungen) als diagnostisches, indikatorisches und prognostisches Instrument. Infolgedessen empfiehlt Argelander die Durchführung dem berufserfahrenen und gut ausgebildeten Psychotherapeuten vorzubehalten, um den besonderen Stellenwert und die Schlüsselfunktion des Erstkontakts zu verdeutlichen. Aufgrund des gewandten Schreibstils und der ausgezeichneten Beschreibung von inner- und intrapsychischem Fremdgeschehen sowohl als Einstiegslektüre geeignet, dient das Meisterwerk dem (angehenden) Psychotherapeuten auch als unentbehrliche Pflichtlektüre. Im Mittelpunkt steht – mit Hilfe dieser Ästhetik der Gesprächsführung – die Kunst, einen Menschen zu verstehen.
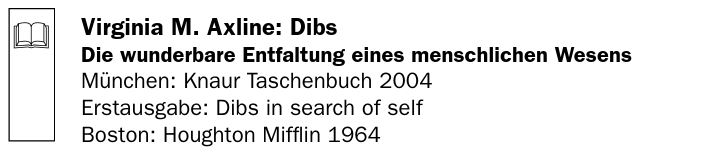
Diese Geschichte beschreibt den Weg eines Kindes, dem es möglich ist, durch Psychotherapie zu sich selbst zu finden. Sein Name ist Dibs. Dibs ist ein ungewöhnlicher kleiner Junge, voller Liebe, voller Leidenschaft, voller Freundschaft, aber auch stumm und zurückgezogen. Eingesperrt in sein seelisches Gefängnis, spricht, lacht und spielt Dibs nicht bis zu seinem fünften Lebensjahr. Doch mit sechs Jahren ist er mit einem Mal aufgeweckt und lebensfroh. Dieses Wunder vollbringt Virginia M. Axline, die das Vertrauen des Jungen gewinnt. Indem sie ihm seinen Raum zu Selbstverwirklichung gibt, hilft sie ihm, seine inneren Barrieren zu überwinden. Anfänglich in sehr kleinen Schritten, vertraut sich Dibs seiner neuen Begleiterin an, zunehmend öffnet er sich und gibt seine Welt und Erfahrungen preis. Durch die Spieltherapie, völlig ohne Druck, wird Dibs die Möglichkeit gegeben, sich auf seine Weise bemerkbar zu machen. Er fängt an, Selbstvertrauen zu gewinnen, seine Fähigkeiten preiszugeben, und zunehmend beginnt sein Leben sich zu ändern. Nicht nur der Junge, auch seine Eltern beginnen sich zu ändern. Das veränderte Verhalten ihres Sohnes veranlasst Mutter und Vater, die Situation in verändertem Licht zu sehen. Es wird ihnen zunehmend möglich, ihren Enttäuschungen auf anderem Wege zu begegnen. Man verfolgt die spannende und mitreißende Entwicklung einer ganzen Familie. Von Anfang an fühlt man sich dem kleinen Dibs stark verbunden, man spürt seine Isolation, den Wunsch nach echter Anerkennung und Vertrauen. Durch ihre einfache Art zu schreiben schafft es Virginia M. Axline, das Wesen und den Charakter des Jungen einzufangen und greifbar werden zu lassen. Das Buch spricht in einer Sprache, die uns in ihrer echten seelischen Not erschüttert. Der kleine Junge verzaubert in seinem Anderssein den Leser so sehr, dass man nicht aufhören kann zu lesen, um endlich das nächste Kapitel zu erreichen und mehr von der Persönlichkeit und der Entwicklung zu erfahren. Eine bewegende Lebensgeschichte öffnet sich Stück für Stück und die furchtbare Verzweiflung und Not des Buben und dessen Familie werden immer greifbarer. Die Spannung, die entsteht, ist fast greifbar, erhitzt das Gemüt und wird zum Treibstoff, der dieses Buch so lesenswert macht. Ein Klassiker, der schon Generationen, ob Jung oder Alt, fesselte und berührte, der aber auch heftige Diskussionen aufgeworfen hat. Ist Dibs Autist, kann man das aus der dargebotenen Beschreibung entnehmen? Oder haben die Eltern schwer versagt, Erziehungsfehler auf der ganzen Linie gemacht und ihr Kind so in die Isolation getrieben? Meiner Meinung nach kann das jeder nur für sich entscheiden, nachdem er dieses hervorragende Werk studiert, durchlebt und den Jungen und seine Familie kennen gelernt hat. Ein Buch der Meisterklasse, für alle, die an einer „Geschichte, die das Leben schrieb“ ihr Herz verlieren wollen.
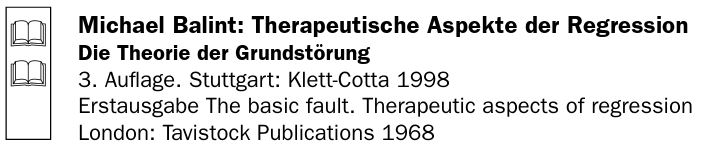
Balint geht von der Frage aus, warum selbst erfahrene und zuverlässige Analytiker gelegentlich mit Patienten zu tun haben, denen sie ratlos bis unsicher gegenüberstehen, und warum deren Therapien mitunter scheitern. Seine Antwort lautet, dass die klassische analytische Technik zwar für Patienten geeignet ist, welche die Deutungen des Analytikers als Deutungen erleben und deren Ich-Struktur in hinreichender Weise gefestigt ist, um die Deutungen in sich aufzunehmen. Andere Patienten sind dazu jedoch nicht fähig, und genau sie bereiten dem Analytiker oft Probleme. Um diese genauer zu skizzieren, unterscheidet Balint zwei Ebenen der analytischen Arbeit, die ödipale Ebene und die Ebene der Grundstörung. Die ödipale Ebene ist 1.) charakterisiert durch eine Dreierbeziehung, bei der außer dem Subjekt zumindest zwei Objekte beteiligt sind. Das können, wie in der ödipalen Situation, zwei Personen sein oder, wie im Zusammenhang mit der Oral- und Analerotik, eine Person und ein Gegenstand. 2.) ist dieser Bereich immer mit Konflikten verbunden, die aus der Ambivalenz herrühren, welche auf der Beziehung des Individuums zu seinen beiden Objekten beruht. Und 3.) kann die konventionelle Sprache der Erwachsenen als angemessenes und tragfähiges Verständigungsmittel verwendet werden. Demgegenüber ist die Ebene der Grundstörung 1.) dadurch charakterisiert, dass alle Vorgänge, die sich auf ihr abspielen, Teil einer Zweierbeziehung sind, welche sich von den herkömmlichen Beziehungen auf der ödipalen Ebene grundlegend unterscheidet. 2.) ist die Dynamik auf dieser Ebene nicht durch Konflikte gekennzeichnet, und 3.) ist dabei die Sprache der Erwachsenen oftmals unbrauchbar und irreführend. Patienten, die sich auf dieser Ebene befinden, spüren, dass ihnen etwas Grundlegendes fehlt, dass sie an einem Defekt leiden und eben nicht an einem Konflikt. Sie sind der Meinung, es sei zu dieser Störung gekommen, weil sie von jemandem enttäuscht worden seien oder jemand nicht seinen Verpflichtungen ihnen gegenüber nachgekommen sei. Darüber hinaus leiden sie unter der großen Angst, auch vom Analytiker enttäuscht zu werden. Die Ebene der Grundstörung ist dann erreicht, wenn es zu einer Veränderung in der Atmosphäre zwischen Analytiker und Patient kommt. Deutungen werden nicht mehr verstanden wie bisher, sondern sehr stark mit Emotionen verknüpft, indem sie mal als Angriff oder Forderung, mal als Liebesbeweis empfunden werden. Um das zu vermeiden, ist es für den Analytiker erforderlich, genau zu spüren, was der Patient in diesen Situationen benötigt, und dazu ist es notwendig, zunächst auf Deutungen zu verzichten, um sich ihm auf gelassene und absichtslose Weise wie eine beliebig verfügbare Substanz zur Verfügung zu stellen. Erlebt der Patient den Analytiker als ein „liebenswürdiges“ Objekt, kann er das Lieben für sich neu entdecken.
Das Buch von Michael Balint ist die Frucht jahrelanger praktischer Arbeit und theoretischer Auseinandersetzungen, von denen Aufsätze seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts zeugen. Lange bevor man sich in der Psychoanalyse an sogenannte Frühstörungen und strukturelle Defizite heranwagte, publizierte Michael Balint seine Arbeiten zur Grundstörung – und löste heftigen Widerstand in der Analytikerszene aus. Zu jener Zeit waren Objektbeziehungstheorien noch nicht Teil des Mainstreams, und es gehörte zum Selbstverständnis des Analytikers, eine „korrekte“ Technik anzuwenden, nämlich die passiv-neutrale Standardtechnik mit ihrer Vorliebe für Deutungen. Auf diese Weise arbeitete zwar auch Balint, aber er tat es nur dann, wenn sich seine Patienten auf der ödipalen Ebene befanden. Waren sie jedoch auf die Ebene der Grundstörung regrediert, verhielt er sich anders, und er prägte dafür einen Begriff, der in die Literatur eingehen sollte, nämlich den der primären Objekte. Die Beziehung zu diesen, vor allem zur Mutter, bleibt während des ganzen Lebens – im ursprünglichen Sinn – primitiver als zu allen anderen Personen, und Balint vergleicht sie mit den vier Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer. Diese sind einfach vorhanden, passen sich dem Körper an und erweisen sich als unzerstörbar. „Ohne Wasser kann man nicht schwimmen, ohne Erde kann man nicht vorwärtsschreiten. Die Substanz, der Analytiker, darf nicht widerstreben, muss einwilligen, muss keinen Anlass zu starker Reibung geben, muss den Patienten für eine Weile annehmen und tragen, muss sich als mehr oder weniger unzerstörbar erweisen, muss nicht auf starren Grenzen bestehen, sondern muss die Entwicklung einer Art von Vermischung zwischen ihm und den Patienten zulassen“ (S. 177). Es handelt sich um eine »elementare« Beziehung, und ähnlich wie die klassischen Elemente Segen und Fluch zugleich sein können, kann es die Beziehung zu einem primären menschlichen Objekt sein. Sie kündet von dem Paradies, aus dem die Menschen vertrieben worden sind und nach dem sie sich sehnen – vor allem dann, wenn es in der frühen Kindheit nicht in hinreichender Weise tragende Funktionen erfüllt hat. Kaum jemand hat diese elementaren Verhältnisse besser beschrieben als Michael Balint.
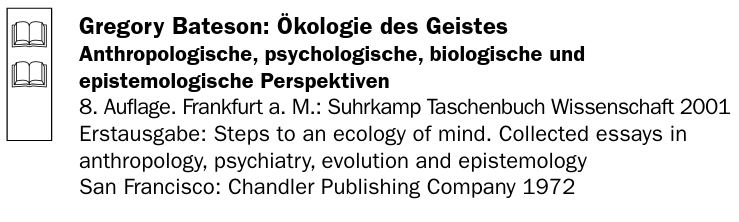
Der Anthropologe Gregory Bateson kann als einer der bedeutendsten Begründer einer ökologischen Theorie von Lebensprozessen gesehen werden. Im vorliegenden erst 1972 erschienen Buch sind Aufsätze und Vorlesungen zusammengetragen, die der Autor über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren im Rahmen verschiedener Forschungsprojekte geschrieben hat. Die Beiträge sind in Themenbereiche geteilt, die einer chronologischen Ordnung von vier sich überlappenden Phasen im Forschungsleben des Autors entsprechen: Anthropologie, Psychiatrie, biologische Evolution und Genetik und Erkenntnistheorie. Als ein zentrales und verbindendes Thema der Aufsatzsammlung zeigt sich der Entwurf einer „kybernetischen Epistemologie“. Eine Erkenntnistheorie, die Erkennen, Denken und Handeln als etwas Unteilbares und Zusammengehöriges beschreibt. Das Modell der Kybernetik sieht er „als einen Weg aus dem Labyrinth von Halluzinationen zu finden, das wir um uns herum geschaffen haben“. Kybernetik als Beitrag zu einer Veränderung, die nicht nur eine Einstellung verändert, sondern auch unser Verständnis davon, was eine Einstellung ist. Seine Argumentation führt zu zwei wesentlichen Thesen: zu einer Theorie des Geistes, die „geistige“ Phänomene als informationsverarbeitende Prozesse versteht. Information kann als „Unterschied, der bei einem späteren Ereignis einen Unterschied ausmacht“, definiert werden. Die zweite These stellt die Betonung von Mustern, von Interaktionen, von Qualität statt Quantität in den Vordergrund. Es sind „die Muster, die verbinden“, die er in seiner Betrachtung herausarbeitet: Sowohl biologische als auch soziale und geistige Phänomene betrachtet er als anders und vor allem auch komplexer als in gängigen theoretischen Konstrukten beschrieben: „Es ist wichtig, die besondere Äußerung oder Handlung als Teil des ökologischen Subsystems, das als Kontext bezeichnet wurde, anzusehen, und nicht als Produkt oder Auswirkung dessen, was vom Kontext übrigbleibt, nachdem das Stück, das wir erklären wollen, aus ihm herausgeschnitten wurde.“ Die in diesem Buch aufgeworfenen Fragen betreffen die Ökologie:
- Was ist die Natur menschlicher Wesen?
- Wie findet eine Wechselwirkung zwischen Ideen statt?
- Wie wissen wir, was wir meinen zu wissen?
- Was ist Psychotherapie, was die Quelle effektiver Therapie?
- Was ist die grundsätzliche Natur von Sprache und Kommunikation?
Warum ein Meisterwerk der Psychotherapie? Gregory Bateson arbeitete und forschte von 1949 bis 1962 als Ethnologe am Veterans Administration Hospital in Palo Alto und veröffentlichte ab dieser Zeit unter anderem seine Studienergebnisse zu Lernen und Kommunikation, zu einer Theorie der Schizophrenie, einer Theorie des Alkoholismus, einer „Kybernetik des Selbst“. Kybernetik – als Teil einer allgemeinen Wissenschaft von Mustern, Regelkreisen und Organisationsformen – ist für ihn die angemessene epistemologische Grundlage und Sprache, mit der persönliche und gesellschaftliche Veränderung beschrieben und konzipiert werden kann. Bateson verwendet Systemtheorie, Kybernetik und Kommunikationstheorie als heuristische Modelle der Untersuchung von Familieninteraktionen. Der Systemtheorie entsprechend fordert er nicht-kausale Stimmigkeit anstelle eines linearen oder wechselseitigen Verursachungsdenkens. Folgende Konzepte der systemischen Familientherapie sind wesentlich auf Batesons Arbeit zurückzuführen:
- Das Konzept einer kybernetischen Epistemologie: die Beobachtung und Beschreibung, wie Menschen ihre Erkenntnisgewohnheiten konstruieren und aufrechterhalten
- Die Bedeutung des Kontextes und der Kontextmarkierung für das Verständnis von Handlungen und Äußerungen
- Die Wahrnehmung von rekursiven Mustern in Interaktionsprozessen
- Das Konzept des „Double-bind“
- Die Bedeutung von Unterschiedsbildungen und Musterunter- brechungen im therapeutischen Handeln
- Interpunktion und doppelte Beschreibung in Beziehungsmustern und Wirklichkeitskonstruktionen
- Die komplementäre Beziehung von Veränderung und Stabilität
Bateson beschreibt psychische Gesundheit nicht als individuelles Phänomen, sondern als adäquate Anerkennung des Beziehungszusammenhanges und vollzieht damit einen Wandel von einer individuell- biographischen Sichtweise zu einer kontextuellen Perspektive. Die kontextspezifische und kybernetische Beschreibung von Problemsystemen verdeutlicht, dass die Therapieeinheit nicht das Individuum, das Paar, die Familie, die Gruppe ausmacht – die Kybernetik bezieht sich auf den Geist, oder anders ausgedrückt, auf die Beziehungen und Bedeutungsgebungen, auf die Muster, die verbinden. Bateson betrachtet menschliche Pathologie als Folge epistemischer Irrtümer:
1. der Glaube an Objektivität
2. Beteiligen an Handlungen, die die Zirkularität eines Systems außer Acht lassen
3. Versuche, ein komplexes System zu kontrollieren
Die Vielfalt der Fragestellungen und Forschungsfelder, die Bateson in diesem Buch anbietet, machen es den Lesern nicht immer leicht zu folgen, bieten jedoch eine fast unerschöpfliche Menge von Ideen und Anregungen, das eigene therapeutische Denken und Handeln selbstkritisch zu reflektieren – somit eine heilsame Kost für jede Versuchung einer therapeutischen Hybris.