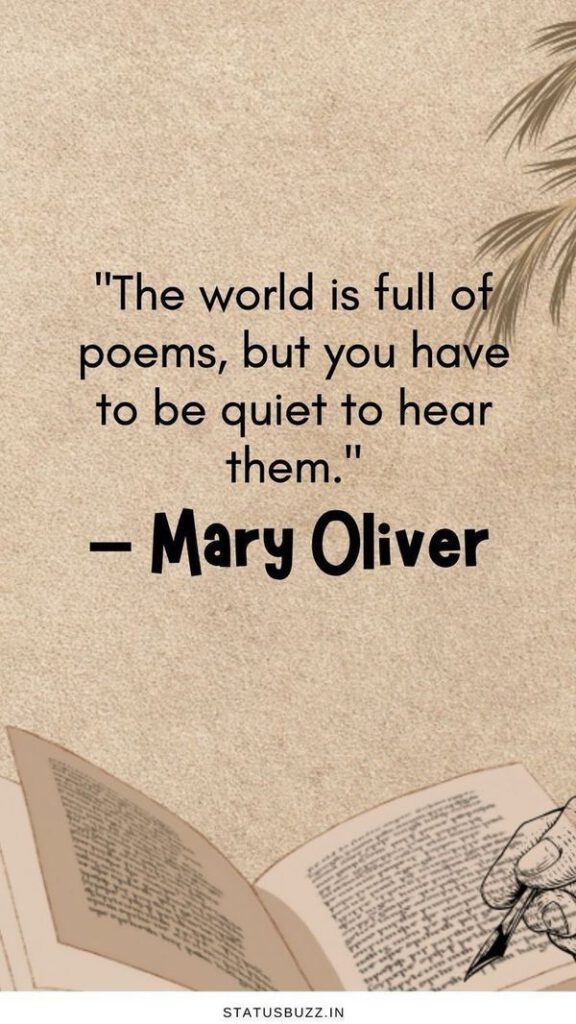Dieses Foto ist bloß ein Fragment, der Abdruck eines Erlebnisses. Am Anfang dieser Geschichte hatte es geregnet. Der Regen fiel mehrere Wochen lang, endlos, und löschte die Farben des Sommers. Der schwere graue Himmel hing über der Stadt, und trübe Gedanken webten ihre unlösbaren Ornamente.
Als die Sonne plötzlich herauskam, fuhr ich sofort ins Grüne, zu einem See. Alles, was sich in meinem Kopf abspielte, verschwand wie ein Spuk in dem grellen Sonnenlicht. Stundenlang saß ich am Wasserrand und schaute vor mich hin. Das Wasser war still, der Himmel spiegelte sich mit seinen Tiefen – das Blaue auf dem grünen Wasser, die weißen Wolken schwammen wie kleine Boote, Halme der Gräser, die Bäume des gegenüberliegenden Ufers. Nur manchmal berührte der Wind die Oberfläche, erzeugte ein leichtes Kräuseln. Insekten summten, und leicht beflügelte Libellen flogen in klirrender Luft. Ich war, als wäre ich zum Blick geworden. Irgendwann fing ich an zu fotografieren. Die Welt zitterte, pulsierte, wie auch die Zeit selbst. Ich blickte auf das Wasser, auf den Himmel im Wasser, auf das Kräuseln und das Zittern der darin vorüberziehenden Wolken, auf die Fische und Pflanzen unter der Wasseroberfläche und wusste irgendwann nicht mehr, ob die Fische im Himmel schwimmen oder die Wolken zum Boden sinken. Ein Espenblatt trieb vorbei. Es war still und rund, sein Schatten aber wedelte mit kleinen Rundungen wie mit Flossen.
Das kleine, zerbrechliche Körperchen einer Libelle
Ich dachte an nichts. All meine Gedanken hatten sich in ein Sehen verwandelt, das sich nun schwer in Worte fassen lässt. Das Erstaunlichste daran war seine Gleichzeitigkeit. Alles, was ich im Fokus sah, was der periphere Blick erfasste und sich im Spiegelbild gegenseitig durchdrang, war zu einer einheitlichen Vision geworden.
Irgendwann verlor ich die Orientierung, die Welt verdoppelte sich wie in einer Sanduhr entlang des Waldes am gegenüberliegenden Ufer des Sees; als lägen „hier“ und „dort“ vor mir, ohne mich mit Fragen nach ihrem Verhältnis zueinander zu beunruhigen. Ich dachte daran, dass auch hinter mir – auf der anderen Seite der Straße – noch ein weiterer See liegt, an einem anderen Waldrand, und das Bild verdoppelte sich abermals, noch einmal, als ob ich in eine Falte des Raums geraten wäre, als ob hinter mir genau dasselbe Universum läge.
Als schließlich alles ganz in allem aufging, sah ich auf der Wasseroberfläche eine tote Libelle; ein kleines, zerbrechliches Körperchen. Das Foto zeigt den Tatort. Ich nahm sie in die Hand – oder vielmehr auf die Hand. Seit meiner Kindheit hatte ich keine mehr berührt – und diese Libelle war tot, ganz und gar. Ihr Tod war eine Gegebenheit unseres Treffens, eine Art Voraussetzung, als ob die tote Libelle genau das wäre, was gerade in mir und in der Welt geschah. Ich hatte keine Intention, ich wollte sie nur anschauen. Ich weiß nicht, wie lange, denn die Zeit schwang mit der Wasseroberfläche in alle Richtungen, und ich konnte mich nicht sattsehen an dem dünnen Schwänzchen, den durchsichtigen, schimmernden Flügelchen, den teleskopartigen blauen Augen.

Libellenwasser
Lange lag die Libelle tot auf meiner Handfläche, und ich konnte meinen Blick nicht von ihr wenden. Vielleicht habe ich doch gehofft? Ich begann sie zu fotografieren, um ihre zart gemusterten Flügelchen besser betrachten zu können, als ihr Schwanz plötzlich zuckte. Ich konnte es kaum glauben. Doch die Bewegungen wurden häufiger. Später – es verging wieder viel Zeit – öffnete sie ihre wie im Gebet gefalteten Beinchen, dann bewegte sie ihre Flügel und richtete sich endlich auf. Könnte meine Aufmerksamkeit sie zurückgeholt haben? Oder hat der See mit allen seinen Spiegelungen sie aus dem Wasser wieder in den Himmel gebracht? Sie flog weg, und ich wusste nicht, wer wen ins Leben zurückgeholt hatte.