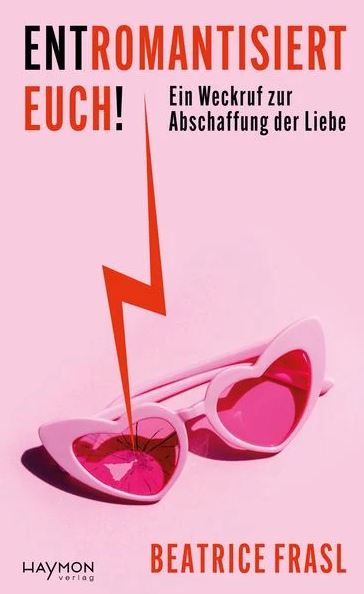Frau Frasl, für viele gibt es nichts Schöneres als das Gefühl, verliebt zu sein. Sie aber schreiben in Ihrem Buch „Entromantisiert euch!“, Verliebtheit sei ein gefährlicher Zustand. Wieso denn das?
Eigentlich ist Verliebtheit ein destruktiver Ausnahmezustand, der in anderen Kontexten auch schon als Krankheit verstanden wurde. Wenn wir das Symptom-Cluster der Verliebtheit in einem anderen Kontext sähen, würden wir sagen: Das ist eine schwerwiegende, psychische Erkrankung. Die Person braucht Hilfe! Verliebt sind wir nicht im Vollbesitz unserer kognitiven Fähigkeiten, können Situationen nicht gut beurteilen. Und in diesem hormonell bedingten Zustand binden wir uns an eine Person. Dabei wissen wir gar nicht, ob sie uns auf lange Sicht guttut – weil wir das in diesem Zustand gar nicht beurteilen können.
Warum verklären wir dann die Verliebtheit?
Die Vorstellung, unser Leben mit einem romantischen Partner zu teilen, ist gar nicht so alt. Das hängt mit der Industrialisierung, der Ausweitung kapitalistischer Produktionsverhältnisse zusammen. Dadurch entstanden eine öffentliche und eine private Sphäre. Die private Sphäre ist weiblich konnotiert, in ihr findet die unbezahlte Arbeit statt. In der öffentlichen Sphäre die Lohnarbeit, die war dann lange Zeit den Männern vorbehalten. Unser Wirtschaftssystem beruht auf der unbezahlten Care-Arbeit von Frauen, Arbeit, die sie „aus Liebe“ erledigen sollen. Der Lohn, den die Frauen dafür bekommen, ist die eigene Liebe. So wurde das Konzept „Liebe“ besonders wichtig und erfüllt eine wichtige patriarchale Funktion: Sie ist der Grund, warum Frauen dienen. Wir werden von klein auf darauf getrimmt, eine Beziehung zu einem Mann und Kinder zu wollen.
Sie schreiben, die romantische Liebe führe dazu, dass uns die Liebe abhandenkommt. Ist das nicht paradox?
Romantische Liebe bedeutet oft, dass wir uns auf eine Person fokussieren. Wir verlieren dadurch den Fokus auf andere Beziehungen, geben ihnen nicht die Energie, Zeit und Sorgfalt, die sie verdienen. So nehmen wir andere Formen von Liebe außer der romantischen gar nicht als Liebe wahr.
Auf der ersten Seite Ihres Buches konstatieren Sie: „Sie werden mich hassen für dieses Buch über Liebe.“ Wer wird Sie hassen? Und warum?
Ich kann diese Frage gar nicht mehr in der Zukunftsform beantworten, weil ich die Reaktionen ja schon gekriegt habe. Es kommen viele ablehnende Reaktionen von Männern und eigentlich sehr viel Zuspruch von Frauen. Häufig versuchen Männer, mich dann persönlich zu beleidigen, zu verletzen in Bezug auf mein Aussehen, meinen angenommenen Beziehungsstatus, mein vermutetes Sexualleben. Was frustrierend ist, ist, dass sich genau diese Leute wohl nie mit meinem Buch auseinandersetzen werden. Dabei sollten auch gerade Männer das Buch lesen!
Sie schreiben auch: „Dieses Buch ist ein Putschversuch“. Worauf beziehen Sie sich?
Ich glaube, der Putsch ist schon im Gange. Das Buch trifft einen Nerv des Zeitgeists. Statistiken zeigen, dass sich Frauen immer mehr aus heterosexuellen Paarbeziehungen hinausbewegen. Frauen brauchen Männer heute nicht mehr so wie früher, als sie nicht arbeiten konnten und kein Bankkonto eröffnen konnten. Die Welt war lange so eingerichtet, dass Frauen systematisch von Männern abhängig waren. Wir haben uns so viel erkämpft in den letzten Jahrzehnten. Wir sind die erste Generation an Frauen, die tatsächlich unabhängig von Männern leben kann. Jetzt ist der Moment, in dem Männer nicht mehr gebraucht, sondern gewollt werden müssen. Und da fallen gewisse Diskrepanzen in der Beziehungskompetenz auf: Frauen sehen, dass zum Beispiel die Beziehungen zu ihren Freundinnen viel besser funktionieren. 70 Prozent der Scheidungen werden von Frauen eingereicht, wir müssen nicht mehr in Beziehungen mit Männern bleiben, wenn wir das nicht wollen.
Gleichzeitig findet, gerade im Internet, eine Radikalisierung von jungen Männern statt. Stichwort „Manosphäre“. Wie beurteilen Sie diese Entwicklungen?
Ich glaube, dass dieser Backlash eine Gegenbewegung zu alldem ist, was ich gerade beschrieben habe. Elon Musk, ein Aushängeschild der amerikanischen Rechten, ist sehr fokussiert auf die Geburtenrate, das Auseinanderbrechen der heterosexuellen Paarbeziehung. Der Frauenhass der Manosphäre ist getragen von einer grundsätzlichen männlichen Anspruchshaltung auf Frauen, auf ihre Fürsorge, ihre sexuelle Verfügbarkeit, ihre Liebe. Gleichzeitig merken diese Männer, dass Frauen all das nicht mehr leisten wollen, weil sie andere Optionen haben, weil sie es nicht mehr müssen. Ich beobachte eine Art Streik der Frauen. Ich befürchte aber, dass die Gegenbewegung sehr gewaltvoll ausfallen kann.

Über die Autorin:
Beatrice Frasl ist Kulturwissenschaftlerin, Geschlechterforscherin, Podcasterin, Kolumnistin und Feministin. In ihren Arbeiten beschäftigt sie sich mit dem Gesundheitssystem, psychischen Erkrankungen und Feminismus. In ihrem Podcast „Große Töchter“ bearbeitet sie geschlechterspezifische, gesellschaftspolitische Fragen. Im April 2025 erschien ihr neues Buch „Entromantisiert euch!“, in dem sie sich mit der Stellung der romantischen Liebe in unserer Gesellschaft auseinandersetzt.
Sind es nur Männer, die solche alten Rollenbilder propagieren?
Ich beobachte gleichzeitig auch, gerade auf Social Media, den Trend, dass Frauen sich als „Tradwife“, also als traditionelle Ehefrau, Hausfrau und Mutter, inszenieren. Ich sehe das aber tatsächlich als Ausdruck desselben Missverhältnisses wie jene Entwicklungen, die zeigen, dass Frauen sich immer mehr aus heterosexuellen Beziehungen hinausbewegen. 40 Stunden arbeiten zu gehen und dann auch irgendwie Kinder großziehen und die ganze Haushalts- und Care-Arbeit machen – das geht nicht! Gewissermaßen kann ich es nachvollziehen, dann eine dieser Aufgaben ablegen zu wollen. Daraus aber den Schluss zu ziehen, sich von einem Mann abhängig zu machen, halte ich für die falsche Entscheidung.
Schon als Kind hatten Sie ein „Vorgefühl bevorstehenden Unheils, das Frausein offenbar mit sich brachte“. Wie meinen Sie das?
Als Mädchen habe ich bei Frauen viel Unglück gesehen. Müdigkeit, Erschöpfung, Traurigkeit. Sie waren gefangen in einem Beziehungsgefüge. Für mich war Frauwerden verbunden mit einem Gefühl von Gefangenschaft, Ausweglosigkeit. Ich erlebte viele Frauen in heterosexuellen Beziehungen, die so viel Potential hatten und sich dann in der dienenden Rolle als Ehefrau und Mutter wiederfanden. Ich selbst habe mich nie in einer Mutterrolle gesehen. Ich habe mich nie in der Rolle der Ehefrau gesehen.
Was wird nach dem Ende der romantischen Liebe aus den Männern?
Ich fürchte, das ist etwas, was die Männer selbst für sich und miteinander lösen müssen. Tatsächlich zeigt uns die Forschung, dass Männer romantische Beziehungen viel mehr brauchen als Frauen, weil sie außerhalb von ihnen zu wenig tragende Beziehungen haben. Männer haben weniger intime Freundschaften als Frauen. Ich glaube, diese emotionale Abhängigkeit ist auch eine Quelle von projektivem Hass, im Sinne von: Ich brauche dich, aber dieses Brauchen ist im Widerspruch zu meiner Männlichkeit, die autonom sein muss, und deshalb hasse ich dich auch. Ich rufe Männer auf, tragende, emotional intime Freundschaften auszubilden. Das wird auch Männer befreien!
Im Kontext von Beziehungen ist Intimität ein wichtiger Begriff. Wie erleben wir Intimität, was fehlt uns?
In der Alltagssprache ist das Wort Intimität oft verknüpft mit der Vorstellung von Sexualität. Dabei kann Intimität viel mehr sein! Ähnlich ist es beim Wort Liebe, das assoziieren wir in der Regel automatisch mit romantischer Liebe. Wir Menschen brauchen Intimität, das gefällt dem neoliberalen Zeitgeist nicht, der uns gern unabhängig und isoliert voneinander sieht. Wir brauchen einander, wir brauchen Gemeinschaft. Wir wissen, welche gesundheitlichen Schäden Einsamkeit verursachen kann. Und wir brauchen auch Körperkontakt, in den Arm genommen werden, wir müssen andere Menschen spüren im physischen Sinne. Kinder herzen und umarmen wir. In weiblichen Freundschaften gibt es eine gewisse Körperlichkeit, die in der Regel dann endet, wenn ein romantischer Partner auf den Plan tritt. Ansonsten erleben wir kaum mehr nichtsexuelle Intimität. Für viele ist es heutzutage einfacher, sexuelle Intimität zu bekommen als nichtsexuelle Zärtlichkeit. Wir suchen auf Dating-Apps nach Sex und sehnen uns eigentlich nach dem Kuscheln danach.
Wie kam es zu dieser Umdeutung von Intimität?
Das ist über zwei Wege passiert: Erstens ist das Erlernen von Männlichkeit sehr stark daran geknüpft, sich körperlich von anderen zu entfernen, zumindest im Sinn körperlicher Zärtlichkeit. Zweitens ist da die Tatsache, dass unsere Gesellschaft nach wie vor homofeindlich ist. In der Kulturgeschichte waren es die Momente, in denen Homosexualität sichtbarer wurde, in denen sich zugleich vor allem Männer in gleichgeschlechtlichen Freundschaften körperlich voneinander entfernt haben. Beides prägt die Art, wie wir platonisch in Beziehung treten.
Sie haben das Thema Einsamkeit angesprochen. Sind Paarbeziehungen nicht genau die Antwort darauf?
Das könnte man auf den ersten Blick denken. Die romantische Paarbeziehung ist aber de facto ein Weg in die Einsamkeit, gerade für Frauen. Frauen ohne Partner haben mehr tragende und engere Beziehungen, sind besser sozial eingebunden. Die Einsamkeit von Frauen in Liebesbeziehungen verstärkt sich wiederum noch, wenn aus dem Paar eine Kleinfamilie wird. Für Mütter wird der Bewegungsradius oft noch kleiner. Das kann massiv gefährlich sein, vor allem dann, wenn diese Beziehung mit einem gewalttätigen Partner stattfindet, was leider in heterosexuellen Konstellationen nicht selten der Fall ist. Denn Isolation ist eine Strategie von Tätern.
Wir müssen also auch über Gewalt in heterosexuellen romantischen Paarbeziehungen reden?
Im Diskurs wird das stark individualisiert besprochen und meist nur, wenn es um besonders schreckliche Fälle geht. Beispielsweise der Fall von Gisèle Pelicot aus Frankreich. Wir sprechen von Tätern als Monstern, als würde man ihnen ihre Gewalttätigkeit ansehen können. Dabei sind es ganz normale Männer – auch Männer, die wir kennen und lieben: unsere Brüder, unsere Väter, unsere Lieblingsarbeitskollegen, unsere besten Freunde. Und: Unsere Vorstellung von romantischen Beziehungen ist durchsetzt von Gewalt. Das fängt mit großen romantischen Gesten in Filmen an, die eigentlich manipulativ und grenzüberschreitend sind. Oft wird psychische Gewalt und Kontrollverhalten romantisiert. Unsere Vorstellung, wie Männer Frauen lieben oder lieben sollen, ist inhärent gewaltvoll.
Ist denn eine feministische Version der romantischen Liebe möglich?
Das ist eine große Frage, die ich im Buch stelle. Die romantische Liebe ist in jedem Fall sehr eng verwoben mit patriarchalen Normen.
Sind offene Beziehungen und Polyamorie da nicht die Lösung?
Auch Polyamorie rückt die romantische Liebe ins Zentrum. Mein Anliegen ist es zu sagen: Es gibt auch andere Formen von Liebe! Platonische Liebe, geschwisterliche Liebe, Liebe in der Gemeinschaft. Ich halte Polyamorie aber auch für ein Symptom unserer Zeit. Wir merken auch daran: Die klassische monogame Hetero-Paarbeziehung funktioniert eben nicht mehr. Menschen suchen nach neuen Modellen.
Kann Onlinedating nicht beim Aufbauen einer solchen „Liebesgemeinschaft“ helfen?
Na ja, ich habe eher den Eindruck, es ist ein Streben nach Verbindung, das am Ende nur zu mehr Einsamkeit führt. Studien zeigen, dass solche Apps sich negativ auf unser Wohlbefinden auswirken. Swipen hat fast den Charakter von „Menschen-Shopping“ angenommen. Es wäre meiner Meinung nach wesentlich zuträglicher, wenn wir uns statt dieser Beziehungsattrappen echten Bindungen zuwenden würden.
Vervollständigen Sie den Satz: „Die romantische Liebe ist tot. Es lebe …!“
Ich weiß nicht, ob romantische Liebe tot ist, aber sie liegt im Sterben. Was ich auf jeden Fall unterschreiben würde: Es lebe die Freundinnenschaft!